Batteriespeicher von Photovoltaik-Anlagen: Wie hoch ist die Brand-Gefahr?
Wie hoch ist das Brandrisiko bei Batteriespeichern von Photovoltaik-Anlagen? Eine Studie der RWTH Aachen kommt zu überraschenden Ergebnissen.
Geraten Batterie-Speicher schneller in Brand als Alternativen? Wissenschaftler der Technische Hochschule Aachen (RWTH) haben die Sicherheit von Batteriespeichersystemen für Photovoltaikanlagen untersucht und sie mit anderen Haushaltsgeräten sowie Elektroautos und Verbrenner-Pkw verglichen.
Dabei kamen sie zu dem Ergebnis: „Die Wahrscheinlichkeit eines Brandes durch Batteriespeicher beträgt 0,0049 Prozent pro Jahr. Dies entspricht einer 50-mal niedrigeren Wahrscheinlichkeit als bei allgemeinen Hausbränden.“ Diese Erkenntnis erlangten sie durch ihre Studie „Quantitative Fire Risk Assessment of Battery Home Storage Systems in Comparison to General House Fires in Germany and Other Battery Related Fires“, die Ende vorigen Jahres in Auszügen auf einer Veranstaltung des Bundesverbandes Energiespeicher Systeme (BVES) in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Kein standardisiertes Meldesystems für Brand-Vorfälle
Die Forscher mussten sich bei ihrer Studie mehreren Herausforderungen stellen, berichtet Mark Junker, Leiter der Studie. Eine der größten war, dass es kein standardisiertes Meldesystems für Brandvorfälle in Deutschland gibt und die meisten Bundesländer recht breite Kategorisierungen für solche Ereignisse nutzen. Um diese Informationslücke zu schließen, wurden Webcrawler eingesetzt und die Studie stützt sich daher auf ermittelte Medienberichte.
Dies ergab für 2023 insgesamt 36 Fälle und für das vergangene Jahr 56. Diese Zunahme sei damit zu erklären, dass 2024 deutlich mehr Photovoltaik-Heimspeicher in Deutschland installiert wurden, als im Jahr zuvor. Den aktuellen Bestand schätzte Junker auf rund 1,6 Millionen Heimspeichersysteme (HSS). In die Studie flossen nur Fälle ein, in denen der Brand im Haus wirklich durch den Batteriespeicher, nicht aber etwa durch das Batteriemanagementsystem oder menschliches Fehlverhalten ausgelöst wurde.
Viele HSS-Brände im Frühjahr
Auffällig war, dass die meisten HSS-Brände in den Frühjahrsmonaten ausbrachen. Die Forscher vermuten, dass das mit der geringen Stromspeicheraktivität in der lichtarmen Winterzeit zu tun haben könnte. Dafür spräche auch die Uhrzeitanalyse: Am häufigsten brannten die Stromspeicher, wenn sie vollgeladen waren, zwischen 12 und 16 Uhr. Umgerechnet auf die Kapazität der Heimspeichersysteme ergab das eine jährliche Brandwahrscheinlichkeit von 0,56 % pro installierter Megawattstunde (MWh).

Um die Höhe dieses Brandrisikos einordnen zu können, verglichen die Aachener Forscher es auch mit dem anderer Haushaltsgeräte und Technologien. Dabei zeigte sich, dass sich die Brandwahrscheinlichkeit bei anderen Haushaltsgeräten nicht wesentlich von der eines hauseigenen Photovoltaik-Stromspeichers unterscheidet. So beträgt das Brandrisiko eines Wäschetrockners 0,0037 % und das eines Kühlschranks 0,0012 %. Alle modernen Haushaltsgeräte haben demzufolge eine allgemein geringe Brandwahrscheinlichkeit, das gilt auch für HSS.
Von Photovoltaik-Anlage bis Verbrennungsmotor
Für PV-Anlagen besteht laut der Studie sogar ein noch geringes Brandrisiko von 0,0014 % pro Jahr und ist damit dreimal geringer. Selbst bei einem großen Batteriespeicher liegt die Wahrscheinlichkeit – vermutlich aufgrund ihres größeren Speichervolumens – jährlich nur bei 0,015 %/MWh pro installierter Megawattstunde.
Bei den Batterien für Elektrofahrzeuge liegt die Rate bei 0,59 % pro Megawattstunde und Jahr. Die Brandwahrscheinlichkeit eines herkömmlichen Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor liegt bei 0,089 % und ist etwa viermal höher als die eines Elektrofahrzeugs. Bei diesen liegt das Brandrisiko bei 0,024. Die Brandwahrscheinlichkeit eines HSS ist damit etwa 18-mal geringer als die eines Verbrennungsmotors und viermal geringer als bei einem Elektrofahrzeug.

viermal höhere Brandgefahr als Elektrofahrzeuge.
© Michael Flippo/stock.adobe.com
Studie könnte Unsicherheiten beseitigen
Die Studie der Rheinisch-Westfälischen Hochschule liefert nach Aussage ihrer Autoren wichtige Erkenntnisse für die Bewertung des tatsächlichen Risikos von Batteriebränden. Damit könne sie helfen, noch bestehende Unsicherheiten bei Verbrauchern – aber auch Regulierungsbehörden – zu beseitigen. Damit erleichtere sie fundierte Entscheidungen über die Integration erneuerbarer Energiesysteme.
Mittlerweile hätten einzelne Hersteller von PV-Heimspeichern bereits reagiert und würde nun verstärkt Lithium-Eisenphosphat- (LFP) in die Batteriespeicher einbauen. Auch hätten die Firmen schon mit Produktrückruf- und -austauschprogrammen begonnen.
——————————————————————————————————————
Die RWTH-Studie (auf Englisch) ist zu finden unter: kurzlinks.de/ RWTH-Studie_Stromspeicher
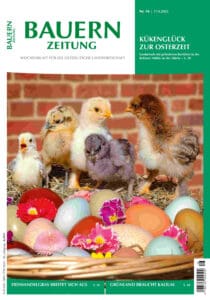
Unsere Top-Themen
- Kükenglück zur Osterzeit
- Erdmandelgras breitet sich aus
- Gülle exakt ausbringen
- Märkte und Preise
Informiert sein



