Weniger Pflanzenschutz und höhere Erträge: Wie Zwischenfrüchte den Boden verändern
Keine Winterfurche und 400 ha Zwischenfrüchte: Unser Praxispartner in Mecklenburg-Vorpommern, die Vipperow Agrar GmbH & Co. KG, betreibt den Zwischenfrucht-Anbau im großen Stil. Erfahrungen aus einem 1.500-Hektar-Betrieb:
Seit zweieinhalb Jahren sind die Betriebsleiter Johannes Gawlik und Martin Groß für den Pflanzenbau auf den rund 1.500 ha Ackerflächen unseres Praxispartners in Mecklenburg-Vorpommern, der Vipperow Agrar GmbH & Co. KG, verantwortlich. Seitdem haben sie einige Methoden zur Bodenbearbeitung und Kultivierung Stück für Stück verändert. „Gerade im Hinblick auf die trockenen Sommer in unserer Region und die leichten Böden stand für uns fest, dass wir die Böden in den Anbaupausen zwischen den Hauptkulturen schützen müssen, damit die Feuchtigkeit im Boden gehalten wird und das Bodenleben gefördert wird“, sagt Johannes Gawlik.
Keine Winterfurche und 400 ha Zwischenfrüchte
Die Praxis der Winterfurche, bei der die Ackerflächen im Herbst schon gepflügt werden, um im Frühjahr bestellt zu werden, sucht man auf den Feldern in den Gemarkungen Priborn, Vipperow und Buchholz vergeblich. „Wir wollen einen intakten Boden haben, der durchwurzelt ist und in dem sich Regenwürmer und sämtliche Mikroben wohlfühlen. Dafür benötigen wir eine Bodenbedeckung“, betont der Junglandwirt.

Die richtige Mischung macht’s: Auswahl der Zwischenfrucht-Arten
Auf 400 ha baut der Betrieb Zwischenfrüchte an, damit fast keine der Flächen zwischen den Hauptkulturen unbedeckt bleiben. Bei der Wahl der Mischungen komme es darauf an, je nach erwünschter Wirkung die passende Art oder Artenmischung auszuwählen. Zum Teil sind es Eigenmischungen, die der Fruchtfolge angepasst werden.
Bestandteile sind abfrierende Zwischenfrucht-Arten wie Buchweizen, Öllein oder Ramtillkraut, die mit keiner Hauptfrucht verwandt sind und daher in jeder Fruchtfolge bedenkenlos eingesetzt werden können. Basis allerdings sei immer Phacelia – sie sei der größte Mischungspartner und füge sich problemlos in die Fruchtfolge ein. Manchmal komme auch die Gründüngungspflanze Serradella in die ZwischenfruchtMischung. „Obwohl wir versuchen, auf Leguminosen zu verzichten, da wir in der Fruchtfolge Erbsen haben und ich keine Leguminosenmüdigkeit provozieren möchte“, sagt Johannes Gawlik.

In Rapsfruchtfolgen verzichtet er vor allem auf Kreuzblütler wie Ölrettich, der die Kohlhernie übertragen kann. Auch Gräser seien in den Mischungen nicht enthalten. So solle verhindert werden, dass Krankheiten auf die Getreidekulturen wie Weizen, Gerste oder Roggen übertragen werden. Zudem müsse der Anbau auf den benachbarten Schlägen berücksichtigt werden.
Reduzierte Bodenbearbeitung dank Zwischenfrucht
„Wenn es um eine erfolgreiche Ernte und eine langfristige Bodengesundheit geht, spielen die positiven Eigenschaften des Zwischenfruchtanbaus für uns eine entscheidende Rolle. Gerade bei der reduzierten Bodenbearbeitung, bei der wir den Boden vor der Saat wenig bis versuchsweise gar nicht bearbeiten.“ Darüber hinaus sei es Ziel dieser Herangehensweise, den Pflanzenschutzmittel- und Düngereinsatz zu reduzieren. Diese Methoden, die heute oftmals als „regenerativ“ bezeichnet werden, seien keinesfalls neu, erklärt Johannes Gawlik. Sie kombinieren althergebrachtes Wissen mit neuen Erkenntnissen und modernen technischen Möglichkeiten.
Mehr als nur Humusaufbau: Resiliente Erträge sichern
„Bodenfruchtbarkeit erhalten und verbessern bedeutet für uns nicht zwangsläufig Humusaufbau, da aufgrund langjähriger organischer Düngung die bodenartenspezifischen Humusgehalte weitgehend vorliegen.“ Vielmehr gehe es darum, langfristig eine resiliente Ertragsgrundlage zu erhalten – und das auch unter veränderbaren Klimabedingungen.
„Natürlich könnten wir den Boden als reines Substrat betrachten und alles mit Mineraldünger ausgleichen. Das würde sicher eine ganze Weile gut gehen. Aber so funktioniert die Natur einfach nicht, und außerdem ist das auch nicht meine Überzeugung. Ich möchte nicht nur zehn Jahre Landwirtschaft betreiben. Vielleicht werden es 30 oder sogar 40 Jahre“, sagt der 26-jährige Landwirt.
Aussaatverfahren im Vergleich: Drohne vs. Direktsaat vs. Scheibenegge
So vielfältig die Ziele des Zwischenfruchtanbaus auch seien, ein gut entwickelter Zwischenfruchtbestand sei immer eine gute Grundlage für die nächste Saison. Im vergangenen Jahr habe man daher unterschiedliche Aussaatverfahren und deren Vor- und Nachteile im direkten Vergleich auf einer Ackerfläche getestet. So wurde auf einem Teilstück das Saatgut noch vor dem Drusch mit einer Drohne über dem Weizenbestand ausgebracht. Ein paar Tage später fuhr der Mähdrescher drüber, und das Stroh, das auf der Fläche blieb, legte sich über das verstreute Saatgut. Durch diesen Wasserpuffer sollen normalerweise ideale Keimbedingungen hergestellt werden. Das allerdings funktioniere nur, wenn genügend Stroh vorhanden sei und die Matte gleichmäßig über dem Zwischenfruchtsaatgut liege, betont Johannes Gawlik. So sei der Feldaufgang im vergangenen Jahr wesentlich ungleichmäßiger als bei der konventionellen Aussaat gewesen.

„Auf der benachbarten Fläche haben wir zuerst einen Striegel eingesetzt, um das Stroh gleichmäßig zu verteilen“, erklärt der Landwirt. Anschließend habe ein Nachbarlandwirt die Aussaat mit einer Direktsaatmaschine vorgenommen. „Daneben haben wir unsere mittlerweile betriebsübliche Variante verglichen. Sie besteht aus einer Scheibenegge mit einer pneumatischen Säeinrichtung. Eine klassische Drillmaschine kommt bei der Zwischenfrucht gar nicht mehr zum Einsatz“, sagt Johannes Gawlik. Denn die Kombination von Aussaat und Stoppelsturz direkt hinter dem Mähdrescher habe zum Ziel, Kosten zu sparen und den Boden so wenig wie möglich auszutrocknen. Dieses Verfahren werde seit zwei Jahren erfolgreich angewendet. Mit den Erkenntnissen des vergangenen Jahres möchte der Betrieb an diesem Verfahren festhalten.
Zwischenfrucht nutzen: Winterweide für Schafe
Die Einarbeitung der Zwischenfrüchte erfolge erst im Frühjahr bei möglichst dafür geeigneten Bodenverhältnissen. Im Idealfall sei der Bestand zu diesem Zeitpunkt abgefroren. Ansonsten müsse mit Mulcher oder Messerwalze nachgeholfen werden. Ebenfalls werden die Zwischenfrüchte seit einigen Jahren von einem Schäfer als Winterweide für seine Tiere genutzt. Der Einsatz von Glyphosat findet nur in Ausnahmefällen statt, wenn noch schwer bekämpfbare Unkrautarten auf den Flächen zu finden sind.

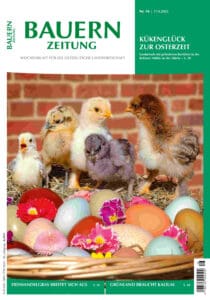
Unsere Top-Themen
- Kükenglück zur Osterzeit
- Erdmandelgras breitet sich aus
- Gülle exakt ausbringen
- Märkte und Preise
Mehr zum Praxispartner



