Biostimulanzien: Was bringen sie wirklich im Pflanzenbau?
Biostimulanzien unter der Lupe: In einem mehrjährigen EIP-Agri-Projekt untersuchten Landwirte aus dem Raum Meißen (Sachsen) gemeinsam mit Partnern die Wirksamkeit von Biostimulanzien. Halten sie, was die Anbieter versprechen?
Biostimulanzien sollen Pflanzen widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Trockenheit machen, die Nährstoffverfügbarkeit verbessern oder das Wachstum anregen. Auch, weil sie als Alternative zu konventionellen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln gehandelt werden, sind sogenannte Biostimulanzien in den letzten Jahren immer stärker ins Gespräch gekommen. Derzeit würden etwa 200 verschiedene Stoffe kommerziell angeboten, sagt Andreas Wilhelm, Agrarberater und Geschäftsführer des Arbeitskreises für Betriebsführung Meißen-Lommatzsch e. V. Was die Mittel jenseits werblicher Versprechen in der Realität bringen, sei indes weitgehend unklar.
Biostimulanzien im Test: Keine klaren Ergebnisse zur Wirksamkeit
Zumindest bis jetzt, denn der Arbeitskreis hat gemeinsam mit der Deutschen Saatveredelung AG und der Hanse-Agro Beratung und Entwicklung GmbH im Rahmen einer Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP-Agri) mit dem Titel „BIOSTim 2030“ versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Über drei Jahre untersuchte das Projekt die Wirksamkeit von Biostimulanzien im Pflanzenbau. Die Ergebnisse sind uneinheitlich. Einen klaren Beleg für die Wirksamkeit von Biostimulanzien liefern sie nicht. Zugleich können positive Effekte anhand der Untersuchungsresultate aber auch nicht ausgeschlossen werden.
Das Projekt BIOSTim 2030: Drei Jahre Forschung
Von 2022 bis 2024 hat das Vorhaben Exaktversuche mit einem ausgewählten Sortiment an Biostimulanzien vorgenommen, die von der A+W FieldScreen Klipphausen GmbH geplant und ausgeführt wurden. Dabei wurden zum einen solche Substanzen eingesetzt, die als Bodenhilfsstoffe gelten (in der Untersuchung „Modul Boden“) und auf die Verbesserung der Nährstoffaneignung der Kulturpflanzen und der Bodenstruktur abzielen, zum anderen Blattapplikationen („Modul Blatt“), die nach Anbieterangaben das Pflanzenwachstum fördern und die Stressresistenz erhöhen sollen.
So wurde die Wirksamkeit von Biostimulanzien in Sachsen geprüft
Die mehrjährigen Feldversuche fanden mit verschiedenen Kulturen auf drei sächsischen Standorttypen (Löss-, Vorgebirgs-, D-Standort) statt. Im Modul Boden prüfte man bei den Winterkulturen zudem mit gestaffelten Düngemengen, die 50 %, 80 % und 100 % des Bedarfs abdeckten, um im Hinblick auf Einschränkungen durch die Düngeverordnung mögliche Alternativen zu prüfen. Die Durchführung der Versuche sei nach den Anwendungsempfehlungen der Vertriebsfirmen erfolgt, da zum Zeitpunkt der Projektplanung keine allgemein anerkannte Richtlinie für Biostimulanzien-Versuche existierte, heißt es im nunmehr vorliegenden Abschlussbericht.
Ermitteln wollten die Beteiligten Antworten auf mehrere Problemstellungen. Verbessern die eingesetzten Mittel Ertrag und Qualität der Ernte? Steigern sie die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stressfaktoren? Wie erfolgreich lässt sich die Anwendung der Mittel mit herkömmlichen Produktionsverfahren kombinieren? Diese und weiteren Fragen standen am Beginn der Versuche. „So komplex hat das bisher niemand untersucht“, ist sich Andreas Wilhelm sicher.
Ertrag und Qualität: Was Biostimulanzien in den Versuchen leisteten (und was nicht)
Allerdings erlauben die Ergebnisse keine abschließende Bewertung. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen uneinheitliche und meist nicht statistisch abgesicherte Effekte der Biostimulanzien auf Ertrag und Qualität in den verschiedenen Kulturen und an den unterschiedlichen Standorten. Zwar zeigten einige Biostimulanzien in einzelnen Jahren bei einigen Kulturen positive Ertragseffekte. Doch konnte dies nicht über die Jahre nachgewiesen werden. In ihrem Abschlussbericht schlussfolgern die Projektbeteiligten, „dass die Anwendungsempfehlungen und beworbenen Erfolgsaussichten für die meisten der geprüften Produkte gegenwärtig noch kritisch zu hinterfragen sind.“
Witterung ist ein Faktor
Offenbar, so schlussfolgern die Autoren des Abschlussberichtes weiter, stehe die Anwendung von Biostimulanzien intensiv mit den gegebenen Umweltbedingungen, vor allem den Witterungsbedingungen nach der Anwendung der Substanzen in Wechselwirkung. Hierzu bedarf es weiterer Untersuchungen.
„Mit BIOSTim 2023 wollten wir auch zeigen, dass wir uns den gesellschaftlichen Forderungen nicht verschließen und selbst nach Wegen suchen, den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren“, schildert Andreas Wilhelm die Beweggründe der Landwirte und ihrer Partner, das EIP-Agri-Projekt durchzuführen. „Agrochemie ist kein Selbstzweck“, so der Agraringenieur. „Landwirte haben ein Eigeninteresse daran, Kosten zu sparen.“
Dass dies in der Breite der Betriebe mit dem Einsatz von Biostimulanzien gelingt, ist indes den Untersuchungsergebnissen zufolge eher unwahrscheinlich, was nicht heißt, dass einzelne Betriebe mit entsprechenden Voraussetzungen, wie präziser Applikationstechnik und erfahrenem Personal nicht doch einen Mehrwert aus dem Einsatz von Biostimulanzien ziehen könnten.
Arbeitskreis für Betriebsführung
Dem Arbeitskreis für Betriebsführung Meißen-Lommatzsch e. V. gehören derzeit 36 Betriebe an. Neben Formaten zur Weiterbildung und zum Erfahrungsaustausch findet unter dem Dach des Arbeitskreises bereits seit 2008 ein Weizensortenversuch zu Fragestellungen wie
Ertrag, Qualität und Düngewirkungen statt.
Ausgeführt wird der Weizenversuch durch die Versuchseinrichtung A&W FieldScreen GmbH Klipphausen, die auch im EIP-Agri-Projekt zu Biostimulanzien die Versuchsdurchführung übernahm.
Weitere Infos zum Projekt und Abschlussbericht zum Download gibt es hier.
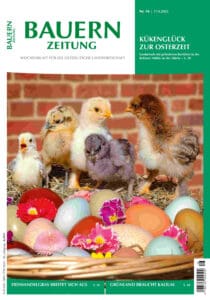
Unsere Top-Themen
- Kükenglück zur Osterzeit
- Erdmandelgras breitet sich aus
- Gülle exakt ausbringen
- Märkte und Preise
Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!



