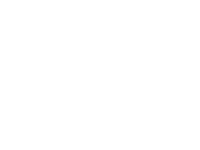Abschied vom Pflanzenschutz: Ein Resümee aus 40 Jahren Erfahrung
Über vier Jahrzehnte war Marlies Mack in Sachen Pflanzenschutz unterwegs. Landwirte zu beraten und sie bei der Arbeit zu unterstützen, war stets ihr Motto. Kaum zu glauben, aber nun geht sie in den Ruhestand.
Frau Mack, Sie gehen demnächst nach vierzigeinhalb Jahren in den Ruhestand. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag im Pflanzenschutzdienst?
Das war ja noch zu DDR-Zeiten. Aber so ganz genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber wir saßen seinerzeit in ziemlich altbackenen Räumlichkeiten hier in Prenzlau. Auch meine Kollegen waren alle schon etwas älter. Aber sie waren heilfroh darüber, wieder eine junge Kollegin im Kollektiv zu haben, die die Blattläuse und Käfer aus den Gelbschalen auch ohne Lupe herauspicken konnte.
In welchem Monat traten Sie Ihren Dienst an?
Begonnen habe ich im September. Da ging es gleich mit den Blattläusen los.

Busch (r.) vom Pflanzengesundheitsdienst teilte Marlies Mack nicht nur
die Faszination für Pflanzen, sondern seit 1988 bis jetzt auch ein Büro. Gemeinsam sind sie durch dick und dünn gegangen. Privat
Mikrobiologie in der DDR studiert
Wie kam es dazu, dass Sie diesen Beruf ergriffen haben und wie hieß die Berufsbezeichnung damals?
Studiert habe ich ursprünglich Mikrobiologie in Greifswald. Wir hatten damals auch eine Studienlenkung. Ich hatte auch schon ein Angebot vom Serumwerk in Dresden. Dort hätte ich Hühnereier für die Impfstoffproduktion beimpft. Auch nach Rostock hätte ich gehen können. Das Fischkombinat brauchte jemanden in der Keimüberwachung. Aber ich wollte in der Nähe meines Elternhauses bleiben und hab mich deshalb rund um Prenzlau beworben. In der Kreispflanzenschutzstelle, wie sie damals hieß, suchte man auch jemanden. Meine Vorgängerin war ins Babyjahr gegangen, und es war abzusehen, dass sie nicht wiederkommt. So bin ich schlussendlich als Biologin zum Pflanzenschutz gekommen. Ich komme vom Dorf, meine Eltern waren aus der Landwirtschaft und ein späterer Kollege kannte meine Eltern. Da hieß es dann, die können wir nehmen, die hat Ahnung. Zwar nicht von den ganzen Pflanzenschutzmitteln, aber von den ganzen Schädlingen, Krankheiten und vor allem den Unkräutern.

Reformen der Behörden
Im Laufe der Jahre gab es unzählige Umstrukturierungen und Reförmchen. Für wie viele Behörden haben Sie schlussendlich gearbeitet?
Angefangen habe ich bei der Kreispflanzenschutzstelle. Das war eine nachgeordnete Einrichtung vom Kreis. Fachlich waren wir aber den Bezirkspflanzenschutzämtern zugeordnet. Für Prenzlau war das das Bezirkspflanzenschutzamt Neubrandenburg. Mit der Wende wurde der Kreis Prenzlau dem Land Brandenburg zugeordnet. Damit wurden wir eine Landesbehörde. Ich habe eigentlich von 1991 an, als das LELF gegründet wurde, immer beim LELF gearbeitet. Egal, ob es LELF oder zwischendurch LVL oder LVLF hieß. Gerade wird mit der neuen Landesregierung ja wieder umstrukturiert. Ob es bei dem Namen LELF bleibt, steht noch in den Sternen. Meine Tätigkeit jedenfalls war in all den Jahren immer dieselbe. Ich war dem Feldbau immer sehr zugetan.
Rückblick auf den Pflanzenschutz
In den vier Jahrzehnten hat sich viel in Sachen Bestandesführung und Pflanzenschutz getan. Was waren aus Ihrer, der pflanzenschutzdienstlichen Sicht die größten Highlights?
Man muss wissen, dass wir vor der Wende ein zum Teil anderes Schädlingsauftreten hatten, als nach der Wende. Nach der Wende bekamen wir zum Beispiel Septoria tritici. Ich weiß noch sehr genau, wann ich das zum ersten Mal auf einem Schlag gefunden habe. Das war damals kurz vor Schmölln. Mir hat niemand geglaubt, und ich musste es zur Untersuchung ins Labor schicken. Auch die Ackerschnecken kannten wir zu DDR-Zeiten nicht. Die haben wir auch erst nach der Wende bekommen. Der Erstfund war damals auch in Schmölln. Dort stand Raps unter einer Schneedecke. Als diese im Frühjahr wegtaute, war auch der Raps verschwunden. Dasselbe mit dem Getreidelaufkäfer. Wir wussten zwar aus Büchern, wie Käfer, Larven und Schadbild aussehen. Aber als wir das Schadbild Anfang der 90er, damals zum ersten Mal in Gerswalde, auffanden, mussten wir den halben Acker umwühlen, bis wir endlich eine Larve fanden. Da haben wir uns dann auch gefreut wie die Schneekönige.

Freundlicher Wettkampf
Im Gegensatz zum Landwirt freut sich der Pflanzenschutzmitarbeiter also, wenn er etwas findet?
Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn wir auf dem Acker die Ursachen zu den bonitierten Symptomen finden können. Es gibt sogar sowas wie einen kleinen Wettbewerb unter den Kollegen, wer den jeweiligen Erstfund, zum Beispiel bei den Rapsstängelrüsslern melden kann. Da hatte ich aber immer schlechte Chancen, weil in der Uckermark die Böden vergleichsweise schwer sind, sich später erwärmen und damit die Schädlinge später starten. Damit musste ich mich abfinden.

Unterschiedliche Aufgaben zwischen früher und heute
Als Sie damals angetreten sind, wie lautete da der Auftrag an die Behörde?
Zu DDR-Zeiten hatten wir als Pflanzenschützer die Aufgabe, die Lebensmittelproduktion zu überwachen und zu kontrollieren, damit die Bevölkerung mit guten und ausreichenden Nahrungsmitteln versorgt werden konnte. Das änderte sich nach der Wende. Da war es egal, wenn bei den Betrieben die Kartoffelmiete im Frost hochhing oder das Getreidelager verschimmelt war. Das spielte plötzlich keine Rolle mehr und war das Pech des Landwirts. Vor der Wende haben wir das alles kontrolliert. Wir haben Mietentagebücher überprüft und auch jede Menge Feldkontrollen gemacht. Im Kreis Prenzlau wurde jede Menge Obst und Gemüse angebaut. Der Landkreis war sozusagen Selbstversorger. Wir hatten Kohl, Kartoffeln und Tomaten. Diese Produktion haben wir vom Feld bis ins Lager überwacht.
Und wie sieht es heute aus?
Nach der Wende standen die Umweltaspekte deutlich mehr im Vordergrund. Jetzt kontrollieren wir eher die ordnungsgemäße Ausbringung der Pflanzenschutzmittel. Aber weiterhin kontrollieren wir Flächen auf Krankheits- und Schädlingsbefall und geben den Landwirten Hinweise, wo sie etwas machen müssen, aber auch, wo nichts unternommen werden braucht. Wir setzen uns auch sehr stark mit den Resistenzen von Schädlingen und Unkräutern auseinander und versuchen, die Praxis bei der Mittelwahl zu unterstützen.

Druck auf Behörden ist hoch
Was Neu- und Wiederzulassungen und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln betrifft, steht die Landwirtschaft seit einiger Zeit sehr unter Druck. Fachbehörden lassen sich trotz geltenden Rechts von Außenstehenden beeinflussen, so wie 2019 beim Verbot des Einsatzes von Karate Forst in Brandenburger Kieferbeständen oder dem jüngsten Beispiel, der Aussetzung der Zulassung von Roundup Future aufgrund eines Einspruchs der Deutschen Umwelthilfe. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein?
Früher ging es in erster Linie um die Produktion. Eingesetzt wurden hauptsächlich Pflanzenschutzmittel aus DDR-Produktion. Wir hatten aber auch schon ein gewisses Kontingent an Importmitteln. Damals wurden Pflanzenschutzmittel zugeteilt. Es gab eine Planung der LPG-Pflanzenschutzagronomen. Die mussten im Winter an uns melden, welche Kulturen in welchem Umfang angebaut werden und welche Mittel sie dafür benötigen. Diese Mittel wurden dann zugeteilt. In erster Linie wurden die Vermehrungsflächen bedacht, auch mit guten Mitteln. Damals waren die Betriebe froh, wenn sie ordentliche und ausreichende Pflanzenschutzmittel bekommen haben. Jetzt ist die Situation ja eine etwas andere. Sie können zwar Mittel bekommen, so sie lieferbar sind. Das Schlimme heute ist aber, dass viele Mittel von heut auf morgen die Zulassung verlieren. Das wird sicher noch lustig in den nächsten Jahren. Allein, wenn ich da an Flufenacet denke, den Wirkstoff, der eigentlich den Ackerfuchsschwanz in Schach gehalten hat. Der wird jetzt wahrscheinlich ganz wegfallen. Das ist angesichts der vielen Resistenzen im Ackerfuchsschwanz ganz traurig.
Sollten Behörden mehr Verantwortung tragen?
Müssten sich die zuständigen Behörden nicht viel selbstbewusster auf geltendes Recht beziehen und Verantwortung übernehmen, statt wider besseren Wissens den Einsatz von PSM zu unterbinden?
Wir setzen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten schon für den Erhalt der Wirkstoffpalette ein. Wir lassen Versuche durchführen. Es gibt eine Mittelprüfung, aber viele der Einschränkungen kommen ja von der EU-Ebene. Fast schon an ein Verbrechen grenzt für mich das Verbot der insektiziden Beizen im Raps. Solange, wie wir ein vernünftiges Insektizid im Raps beizen durften, war alles schick. Rapserdflöhe kannten wir vor der Wende nicht und auch nicht danach. Wir hatten keinerlei Auflaufprobleme beim Raps. Der Rapserdfloh schaukelte sich erst hoch, seitdem die guten Beizen alle weg sind. Kaum ist der Raps aufgelaufen, sind die Blattläuse da. Im letzen Jahr war es teilweise so schlimm, dass große kräftige Pflanzen augrund der Pfirsichblattläuse eingegangen sind. Diese Läuse haben eine starke Resistenz gegen alle Pyrethroide, da hilft eigentlich nur noch Tepekki. Heute wird im Herbst bis zu drei Mal mit einem Insektizid in die Fläche gefahren, wo eigentlich keine Behandlung nötig wäre, wenn man vernünftig beizen könnte.
Pflanzenschutz in Brandenburg stärken
Frau Mack, Sie werden von den Betrieben, den Landwirten in Ihrer Region geachtet und Ihr Rat geschätzt. Viele wollen sich noch nicht an den Gedanken gewöhnen, dass es von nun an ohne Frau Mack weitergehen soll. Welchen Rat wollen Sie vor allem dem Berufsnachwuchs mit auf den Weg geben?
Die Landwirte hier in der Uckermark sind in der günstigen Situation, dass ich eine junge Kollegin seit knapp vier Jahren gut einarbeiten konnte. Ich hab sie auch immer an die Hand genommen und bei den Betrieben vorgestellt, sodass sie inzwischen bei den Landwirten bekannt und akzeptiert ist. Sie ist sehr hinterher, und ich bin sehr optimistisch, dass sie in meinem Sinne weiter für den Ackerbau und die Landwirte agieren wird. Ich würde mir aber wünschen, dass der Außendienst des Pflanzenschutzdienstes in Brandenburg zukünftig wieder gestärkt wird. Wir sind einfach zu wenige Kollegen in der Fläche. Wenigstens sind Stellen im Außendienst aber wieder ausgeschrieben.

Bleiben Sie dem Pflanzenschutz auch nach Ihrem offiziellen Renteneintritt erhalten?
Ein paar Landwirte haben meine private Handynummer bekommen, über die sie mich auch schon kräftig mit Fotos von Schadsymptomen und Käfern „versorgen“ und um Rat fragen. Aber jetzt ist erstmal Zeit für die Familie und vor allem die Enkelkinder. Aber wenn der Raps blüht oder die Zuckerrüben die Reihen schließen, werde ich immer da sein.

Unsere Top-Themen
- Schwerpunkt Maisanbau
- Alternativen zum Diesel
- Kühe raus – Färsen, Ochsen oder Bullen rein
- Märkte und Preise
Informiert sein

Regionale Neuigkeiten erfahren
Kartoffel-Verarbeitung in Kalbe: Warum Grocholl die Produktion einstellt
Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!