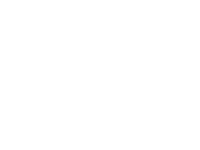Der Streit im Umgang mit dem Wolf geht weiter. Auch wenn der Abschuss von Wölfen künftig leichter gehen soll, haben gleich mehrere Verbände die Zusammenarbeit mit dem Weidetier-Wolf-Zentrum aufgekündigt. Das kommentiert Ralf Stephan.
Der Kragen geplatzt ist jetzt den Verbänden der Landnutzer beim Thema Wolf. Wieder einmal, muss man angesichts ihrer immer wieder vorgetragenen Kritik an der politischen Geringschätzung ihrer Interessen sagen. Jetzt ziehen sie tatsächlich Konsequenzen: Bauernverband, Landesschafzuchtverbände, Deutscher Jagdverband, Reiterliche Vereinigung, der Bundesverband Rind und Schwein, die Wildtierhalter und die Ziegenzüchter beenden die Zusammenarbeit mit dem Bundeszentrum für Weidetiere und Wolf (BZWW). Sie begründen den Schritt damit, dass die im Frühjahr 2021 eingerichtete Plattform von Anfang nicht ihrem Auftrag gerecht geworden sei, den Konflikt zwischen Weidetierhaltung und Wolf zu entschärfen.

Unsere Top-Themen
• Deutsches Gelbvieh
• Seuchenalarm in Brandenburg
• Saatgut ernten
• Märkte und Preise
Wölfe in Ostdeutschland: Weidetier-Wolf-Zentrum Eklat
Ahnungslos gibt sich das Bundeslandwirtschaftsministerium. Dort ist man der Überzeugung, dass die Arbeit des BZWW „bislang gut angenommen und umgesetzt worden“ sei, wie es in der offiziellen Reaktion auf die Kündigung hieß. Wird möglicherweise im Hause Özdemir die Eingangspost nicht gründlich gelesen? Denn die beteiligten Weidetierhalterverbände hatten dem Minister ihre Kritik schon vor über einem Jahr schriftlich mitgeteilt und ihre weitere Mitarbeit infrage gestellt. Das BMEL weicht aus und behauptet, das geforderte Bestandsmanagement sei grundsätzlich unvereinbar mit der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH). Es könne daher gar nicht Gegenstand der BZWW-Arbeit sein.
Umgang mit dem Wolf: Viele Fragen offen
Auf ihrer Webseite zählt die Plattform „die Herangehensweisen zum Umgang mit dem Wolf, die in anderen EU-Mitgliedsstaaten angewendet werden“ jedoch ausdrücklich zu ihren Diskussionsthemen – was nebenbei belegt, dass diese angebliche Unvereinbarkeit mit der FFH-Richtlinie nicht in allen Mitgliedstaaten so gesehen wird. Abgesehen davon ließ das BZWW aber auch eine ganze Reihe anderer wichtiger Themen liegen, die noch vor einem Bestandsmanagement zu regeln wären. So hatten die Verbände darauf gedrängt, die Rissbegutachtungsverfahren zu harmonisieren und nicht zäunbare Gebiete mit hohem Grünlandanteil und hoher Weidetierdichte festzulegen. Beides blieb ohne konkretes Ergebnis.
Umgang mit Wölfen: Zu viel Bürokratie bei Regeln
Darauf aber geht das Ministerium nicht ein, findet stattdessen salbungsvolle Worte. Man setze „auf Kommunikation statt auf Konfrontation und sehe auch in Zukunft einer konstruktiven und lösungsorientierten Zusammenarbeit mit den Weidetierhaltern entgegen“. Reden ist das neue Handeln – an diesem Grundsatz scheint das BMEL festhalten und damit das Schicksal der Weidetierhaltung weiter dem Bundesumweltministerium nebst dessen Behörden überlassen zu wollen. Die jetzt von der Umweltministerkonferenz bestätigten Möglichkeiten der erleichterten Entnahme werden trotz anderslautenden Bekundungen die Weiden kaum sicherer machen. Dafür sind die Regeln immer noch zu bürokratisch und verkopft. Das Leben da draußen ist so anders, dass politische Kosmetik nicht mehr hilft.
Protest zu Politik zum Wolf
Wenn aus Protest gegen die Wolfspolitik in diesem Land wieder ein Wolfsberater zurücktritt, dann ist das kaum noch eine Meldung wert. Wenn aber – wie im niedersächsischen Rotenburg – Vorstände des Grünen-Kreisverbandes ihr vollstes Verständnis für den Schritt ausdrücken und sich der Kritik anschließen, dann sollte das aufhorchen lassen. Die Anzeichen dafür, dass diese Politik immer mehr den Rückhalt verliert, könnten kaum deutlicher sein.
Hintergrund zum Kommentar
Die Umweltminister der Länder haben die Vorschläge von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) für eine unbürokratische Entnahme von Problemwölfen am Freitag, 1. Dezember, einstimmig angenommen. Laut den von Lemke im Oktober vorgelegten Vorschlägen dürfen Wölfe, die Weidetiere gerissen haben, innerhalb von 21 Tagen ohne genetischen Nachweis im Umfeld von 1 Kilometer um die betroffene Weide geschossen werden. Dabei kann es sich auch um den ersten Übergriff des Wolfs auf Nutztiere handeln.
Zuvor hatten acht Verbände mitgeteilt, dass sie künftig nicht mehr mit dem Bundeszentrum für Weidetiere und Wolf (BZWW) zusammenarbeiten wollen. Wie der Deutsche Bauernverband (DBV) mitteilte, wird das Bündnis aus Landwirtschafts-, Jagd- und Weidetierhalterverbänden die Mitarbeit im Gremium einstellen. Den Angaben zufolge haben die Verbände die Staatssekretäre im Bundeslandwirtschafts- und im Bundesumweltministerium, Silvia Bender und Stefan Tidow, in einem gemeinsamen Brief über ihre Entscheidung informiert. Die Verbände werfen der Bundesregierung vor, sie habe nicht auf ihre Kritik an der Arbeit des Bundeszentrums reagiert.
Kommentar aus der Ausgabe 49/2023
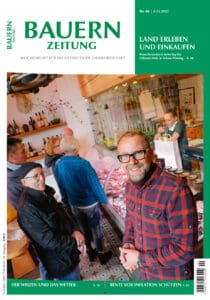
Top Themen:
- Tag der offenen Höfe in TF
- Der Weizen und das Wetter
- Rente vor Inflation schützen
- Einzelheft ohne Abo in der App verfügbar
Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Auch interessant

Auf dem 30. Meistertag feierte sich am Freitag, den 1. Dezember 2023, die Grüne Branche aus Brandenburg am Seddiner See selbst: Die neuen Meister bekamen ihre Urkunden, und die besten Auszubildenden ihres Jahrganges wurden ausgezeichnet.
Meister zu sein, bedeute nicht nur fachliches Vermögen, sondern auch, seine Expertise an andere weitergeben zu können und die Grundlagen zu haben, um einen Betrieb zu leiten, der am Markt erfolgreich ist. So formulierte es Dr. Gernod Bilke, Referatsleiter Berufliche Bildung am Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, bevor die ersten Meister am Freitag, dem 1. Dezember 2023, in der Heimvolkshochschule am Seddiner See ihre Urkunden bekamen.

Unsere Top-Themen
• Deutsches Gelbvieh
• Seuchenalarm in Brandenburg
• Saatgut ernten
• Märkte und Preise
Meistertag am Seddiner See: Landwirtschaftsmeister mit Urkunde
„Und nun vergleichen Sie das mal mit einem Hochschulabschluss“, so Bilke weiter. Der Meister sei nicht weniger wert, betonte er. Zu denen, die ihre Urkunde zum Landwirtschaftsmeister bei der Feier entgegennahmen, gehören sechs Absolventen der Landwirtschaftsschule Seelow und einer aus Oranienburg.
Bildergalerie: Landwirtschaftsmeister geehrt
Dass die zweijährige Meisterausbildung, die bekanntlich neben der Arbeit stattfindet, besonderer Anstrengungen bedarf, belegen die Zahlen: Von 48 Meisteranwärtern in zehn Berufen haben es 32 geschafft, bei den Landwirten neun von 16, bei den acht Galabau-Meistern die Hälfte sowie elf von 14 Forstwirtschaftsmeistern.
Der Meisterbrief: „Ein Ritterschlag, den es nicht zum Nulltarif gibt“, so Jörg Kotenbeutel, Vorsitzender des Prüfungsausschusses Pferdewirtschaftsmeister in seiner Rede. In diesem Bereich erreichten sechs von acht ihr Ziel.
Die besten Azubis im Jahr 2023
Traditionell werden am Meistertag auch die besten Auszubildenden des Jahrgangs und ihre Ausbildungsbetriebe geehrt; sind sie doch am ehesten motiviert, später selbst einen Meisterabschluss anzustreben.

Festredner Enrico Backs, Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses, ermunterte in seiner Rede die jungen Leute, sich einzubringen, wenn ihnen etwas an der Ausbildung nicht gefallen habe, die Älteren mit ihrer Wachheit voranzutreiben. „Genies fallen nicht vom Himmel. Sie müssen Gelegenheit zur Ausbildung und Entwicklung haben“, zitierte er August Bebel, bevor Urkunden und Präsente der Berufsverbände überreicht wurden. Insgesamt wurden 32 Auszubildende und 27 Betriebe in elf Berufen geehrt. Jeder hatte mit mindestens 1,9 abgeschlossen.
Bildergalerie: Azubis am Seddiner See geehrt
Bei den Landwirten waren dies:
- Rika Hummel (Agrargenossenschaft „Thomas Müntzer“ Krahne),
- Theresa Meta Korn (Agrargenossenschaft Drahnsdorf),
- Luise Richter (Landwirtschaftsbetrieb Schallmea),
- Johannes Jahnke (Agrargenossenschaft Karstädt),
- Alexander Kossatz (Agrargenossenschaft Radensdorf).
Bei den Tierwirten:
- Saskia Zijlstra (Agrar- und Milchproduktion GbR Platkow),
- Merle Inga Bornstein (Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Buchholz),
- Jessica Zierock (Agrargenossenschaft Uckermark agrar Göritz).
Bei den Fachkräften Agrarservice:
- Eric Kühne (Landgut Reppinichen GmbH),
- Daniel Denis Guhl (Leibniz-Institut für Agrartechnik),
- Diana Susanne Kern (Agro-Service Luckau GmbH).
Gedankt wurde auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Prüfungsausschüsse.
Auch interessant

Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Wer am Albrecht-Daniel-Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften an der Humboldt-Uni Berlin studiert, beschäftigt sich mit Problemen der Ernährung, Einwicklung und der Ressourcen-Frage in einer Welt mit Konflikten.
Von Ulrike Bletzer, Bad Ems
Mit insgesamt rund 1.500 Studierenden ist das Albrecht-Daniel-Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin die zahlenmäßig größte Bildungseinrichtung ihrer Art in den neuen Bundesländern. Aber das ist bei Weitem nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal.
„Was unser Institut darüber hinaus vor allem auszeichnet, ist die Nähe zur Politik“, beschreibt der geschäftsführende Direktor, Prof. Dr. Martin Odening, die Tatsache, dass das Institut seinen Sitz in der deutschen Hauptstadt und damit dort hat, wo Agrarpolitik gemacht wird.

Unsere Top-Themen
• Deutsches Gelbvieh
• Seuchenalarm in Brandenburg
• Saatgut ernten
• Märkte und Preise
Studium am Albrecht-Daniel-Thaer-Institut: Forschnung und Bildung
Hinzu kommt: In Berlin und Umgebung gibt es eine hohe Konzentration an agrarwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, zu denen das Thaer-Institut sehr intensive Kontakte unterhält. Dazu zählen:
- die Leibniz-Institute für Agrartechnik und Bioökonomie in Bornim,
- für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbeeren/Erfurt,
- für Gewässerökologie und Binnenfischerei im Forschungsverbund Berlin
- das Leibnitz-Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung in Müncheberg
- das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung,
- das Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow,
- das Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf,
- das Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere in Schönow
- die Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung in Groß Kreutz.
„Mit einer ganzen Reihe dieser Institute arbeiten wir in Form von Sonderprofessuren zusammen, sodass den Studierenden ein riesiger Schatz an Wissen und Erfahrung zur Verfügung steht“, berichtet Prof. Odening.

Thaer-Institut: Sonderprofessoren als Hochschullehrer
Sonderprofessoren oder S-Professoren sind von der Humboldt-Universität berufene Hochschullehrer, die auch in einer außeruniversitären Forschungseinrichtung tätig sind. S-Professuren und Honorarprofessuren mitgerechnet, unterrichten insgesamt 34 Professorinnen und Professoren am Thaer-Institut. Es gliedert sich in das Department für Agrarökonomie sowie das Department für Nutzpflanzen- und Tierwissenschaften. „Allerdings sind nur 15 dieser Kolleginnen und Kollegen ausschließlich am Thaer-Institut tätig“, präzisiert Prof. Odening.
Doch zurück zu den Alleinstellungsmerkmalen: Dazu zählt der Standort in Berlin – Einrichtungen des Instituts befinden sich sowohl in Berlin-Mitte als auch im Norden der Hauptstadt sowie im südwestlich gelegenen Stadtteil Dahlem – natürlich nicht nur wegen der Nähe zur Politik, sondern auch deshalb, weil die Metropole Berlin mit ihrem pulsierenden Leben für junge Menschen per se ausgesprochen attraktiv ist.
Absolventen der agrar- und gartenbauwissenschaftlicher Studiengänge bietet sie darüber hinaus eine Fülle von beruflichen Möglichkeiten – unter anderem, weil hier zahlreiche Interessenverbände aus dem Agrarsektor ansässig sind und sich über viele Jahre hinweg eine sehr aktive Start-up-Szene entwickelt hat. Und: Da Berlin einer der größten Absatzmärkte für ökologisch produzierte Lebensmittel ist, kann man in diesem Bereich bereits während des Studiums umfassende Einblicke in die Verarbeitung und Vermarktung gewinnen.
Gartenbauwissenschaften studieren
Außerdem unbedingt erwähnenswert: Als einziges Universitätsinstitut in Deutschland bietet das Thaer-Institut das Studium der Gartenbauwissenschaften in seiner gesamten Bandbreite, das heißt also mit sämtlichen dazugehörenden Fachgebieten, an.
Genau aus diesem Grund habe sie sich dafür entschieden, am Thaer-Institut zu studieren, erzählt Charlotte Bunn, die ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen kommt und sich aktuell im fünften Semester des Bachelorstudiengangs Gartenbauwissenschaften befindet. „Auch besteht hier eine ziemlich enge Bindung zu den Professoren. Ihnen ist es persönlich wichtig, dass wir Studierenden etwas vom Studium mitnehmen“, beschreibt sie die konstruktive Atmosphäre.
Die beiden sechssemestrigen Bachelorstudiengänge Agrarwissenschaften und Gartenbauwissenschaften halten sich, von der Zahl der Studierenden her gesehen, in etwa die Waage. „Jeder dieser Studiengänge verzeichnet pro Jahr circa 150 Neueinschreibungen“, erläutert Prof. Odening.
Studium: Vielfältige Aspekte der Landnutzung
Für die Studierenden des Bachelorstudiengangs Agrarwissenschaften stehen unter anderem die Fachgebiete Biologie der Pflanzen und Ökologie (sechs Pflichtmodule im 1. Semester), Analyse und Planung von Agrarbetrieben (vier Pflichtmodule im 2. Semester), Genetik, Tier- und Pflanzenzüchtung (jeweils vier Pflichtmodule im 3. und 4. Semester), Agrarmarketing und Qualitätsmanagement (sechs Pflichtmodule im 4. Semester) sowie Agrarpolitik und ländlicher Raum (ebenfalls sechs Pflichtmodule im 4. Semester) auf dem Lehrplan. Im 5. und 6. Semester belegen die Studierenden dann verschiedene Wahlmodule.
Die Studieninhalte sind natürlich immer im Zusammenhang mit dem Leitbild des Thaer-Instituts zu sehen. Dazu heißt es auf der Homepage des Instituts: „Leitbild für die Lehre sind Absolventen und Absolventinnen, die auf der Basis fundierter natur-, wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Kenntnisse die ökologischen, technischen, sozialen und ökonomischen Aspekte einer nachhaltigen Landnutzung verantwortlich reflektieren, beurteilen und umsetzen können. Große Aufmerksamkeit wird der Entwicklung von Methodenkompetenz als Beitrag zur Befähigung zum lebenslangen Lernen gewidmet. Förderlich hierfür sind neben einer fundierten Vermittlung der theoretischen Grundlagen auch eine Einbeziehung in Forschungsarbeiten und die Möglichkeit, selbstverantwortlich Forschungsprojekte einzeln und in Gruppen durchzuführen.“
Studienreform aufgrund begrenzter Ressourcen
Wichtig zu wissen: Im Zuge der geplanten Studienreform sollen die beiden Bachelorstudiengänge zum Wintersemester 2024/2025 zusammengeführt werden. Nicht zuletzt dürfte die Zusammenlegung auch den begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen geschuldet sein.
Der einzige Kritikpunkt, den sie an ihrem Studium anzubringen habe, sei die in ihren Augen etwas zu einseitige Fokussierung auf das theoretische wissenschaftliche Arbeiten, sagt Charlotte Bunn und schickt hinterher: „Mit der Zusammenlegung werden sicherlich Kapazitäten frei, um mehr Exkursionen und andere Praxisveranstaltungen anbieten zu können.“
Apropos Studienreform: Sie betrifft auch die Masterstudiengänge, die aktuell noch sechs an der Zahl sind. So wird der Studiengang Prozess- und Qualitätsmanagement in Landwirtschaft und Gartenbau ab dem Wintersemester 2024/2025 voraussichtlich nicht mehr angeboten.
„Das Profil dieses Studiengangs ist offensichtlich nicht stark genug ausgeprägt – die Tatsache, dass sich pro Jahr nur zehn bis 15 Studierende hier einschreiben, legt diese Vermutung jedenfalls nahe“, sagt Prof. Odening. Ebenfalls nicht beibehalten wird der Masterstudiengang Fish Biology, Fisheries and Aquaculture, der bisher ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Thaer-Instituts war.
Allerdings: Sowohl beim Prozess-und Qualitätsmanagement als auch bei der Fish Biology werden einzelne Studieninhalte in andere Masterstudiengänge integriert. „Außerdem können die jetzigen Studierenden ihr Studium natürlich zu Ende führen“, ergänzt Prof. Odening. „Das gilt auch für diejenigen, die sich erst jetzt zum Wintersemester 2023/2024 eingeschrieben haben.“
Masterstudiengänge haben sich bewährt
Auf jeden Fall weiterbestehen werden die Masterstudiengänge Integrated Natural Resource Management und Agricultural Economics als die beiden Erfolgsmodelle, die sich, wie der Direktor des Thaer-Instituts berichtet, über viele Jahre hinweg bewährt und fest etabliert haben. „Beim Studiengang Integrated Natural Ressource Management haben wir deutlich mehr Bewerbungen, als wir Studierende aufnehmen können“, sagt er. Auch der Studiengang Agricultural Economics sei sehr gut besucht.
Dazu kommen zwei Masterstudiengänge, die im Rahmen des Erasmus+-Programms der Europäischen Kommission laufen: Den Studiengang International Master in Rural Development bietet die Humboldt-Universität Berlin in Zusammenarbeit mit der Universität Gent (Belgien), dem Agrocampus Ouest (Frankreich), der Universität Córdoba (Spanien), der Agraruniversität Nitra (Slowakei) und der Universität Pisa (Italien) an. Dabei haben die Studierenden eine Hauptuniversität, absolvieren aber ein oder zwei Semester an einer der Partner-Unis.
Auch interessant

Eine ähnliche Kooperation besteht auch beim Masterstudiengang International Master in Horticultural Science, den Charlotte Bunn im Blick hat. Dieser erfolgreiche Studiengang wird im Rahmender Studienreform zum Master-Studiengang Horticultural and Plant Sciences weiterentwickelt. Er soll zur Profilierung des Instituts beitragen. „Bevor ich nach dem Bachelorabschluss meine Entscheidung treffe, möchte ich allerdings erst eine Praktikumsphase einlegen und währenddessen in verschiedene Masterstudiengänge hineinschnuppern“, sagt Charlotte Bunn, die sich auch über das eigentliche Studium hinaus engagiert, indem sie im Institutsrat die Stimme der Studierenden vertritt.
Damit sind noch nicht alle Studienangebote genannt: Am Seminar für ländliche Entwicklung, das – wie das Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte und das Institut für Genossenschaftswesen – ebenfalls zum Thaer-Institut gehört, kann man das einjährige Postgraduiertenstudium Internationale Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung absolvieren.
Studiengänge auf Englisch
Es ist natürlich kein Zufall, dass die meisten Masterstudiengänge englischsprachig sind: Das Thaer-Institut, an dem sehr viele ausländische Studierende aus anderen europäischen Ländern, aber auch aus Afrika, Asien und, in geringerem Umfang, aus den USA immatrikuliert sind, legt großen Wert auf Internationalität – ein Prinzip, das ebenso für die Forschung gilt.
Bleibt noch die Frage, wo die Absolventinnen und Absolventen des Thaer-Instituts später arbeiten. „Da unsere Studierenden nicht in erster Linie von landwirtschaftlichen Betrieben kommen, liegt der Schwerpunkt auch nicht ausschließlich auf der Primärproduktion“, antwortet Prof. Odening und präzisiert: „Viele arbeiten in vor- und nachgelagerten Bereichen, der Agrarverwaltung, in anderen landwirtschaftlichen Einrichtungen, bei Nichtregierungsorganisationen oder bei Banken und Versicherungen.“
Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Wie sieht der Alltag einer Milchkönigin aus? Die Bauernzeitung sprach mit Maria Brouwer über ihren Weg dahin und über ihre Pläne. Parallel zu Ihrer Arbeit im Betrieb der Eltern in Meyenburg studiert die Landwirtin an der Fachschule in Güstrow.
Das Gespräch führte Wolfgang Herklotz
Ein grauer Novembertag. Über den Buchenhof am Rande von Meyenburg ziehen Nieselschwaden, die nasse Kälte kriecht überall hin. Maria Brouwer lässt sich davon nicht beeindrucken. Sie zieht ihre blaue Softshelljacke über und klettert auf den Radlader. Sie steuert ihn zum Futtergang des Milchviehstalls, um dort die würzig riechende Silage zu verteilen. Routiniert dirigiert sie den „Weidemann“ auch rückwärts und durch enge Passagen.

Unsere Top-Themen
• Deutsches Gelbvieh
• Seuchenalarm in Brandenburg
• Saatgut ernten
• Märkte und Preise
Anschließend kontrolliert Maria die Melkanlage und wechselt den Milchfilter aus, der die Milch im Kühltank vor Verunreinigung schützt. Es sind nur wenige Handgriffe nötig, weil offensichtlich unzählige Male geübt. Schon setzen sich brummend die Kühe Richtung Melkstand in Bewegung, darunter auch Streifi. Das Tier mit dem markanten Streifen über dem Flotzmaul ist besonders zutraulich und beansprucht gern ein paar Streicheleinheiten für sich, erfahren wir.
Nun sind noch die Kälber zu versorgen, die aufs Futter warten. Maria schnappt sich eine Forke und befördert das neben dem kleinen Stall gelagerte Heu kraftvoll durch die schmale Luke. Das FKK-Prinzip gilt immer noch? „Zumindest für Forke und Karre, aber die Kiepe ist längst abgeschafft“, lacht Maria. Dann schlüpft sie aus den Gummistiefeln und führt uns in die geräumige Wohnküche, wo schon eine Kanne Tee auf uns wartet.

Milchkönigin 2023 aus Brandenburg: Interview mit Maria Brouwer
Haben Sie in jungen Jahren davon geträumt, mal eine Königin zu sein?
Wohl eher davon, eine Prinzessin zu werden. Aber eine Karriere als Milchkönigin hatte ich damals nicht im Sinn, das steht fest.
Sie sind aber doch auf einem Bauernhof in Ostfriesland mit Dutzenden Milchkühen aufgewachsen und waren sicherlich frühzeitig auch im Stall unterwegs?
Das schon, muss aber nicht unbedingt dazu führen, dass man sich später für diese Richtung entscheidet. Mit zehn, zwölf Jahren war Landwirtschaft für mich überhaupt kein Thema. Ich hatte auch später noch keine Vorstellungen, wo die Reise hingeht, wollte erst mal mein Abitur machen. Allerdings stand ich dann schon jedes zweite Wochenende im Stall, habe beim Melken mitgeholfen. Da war aber eher ein Zwang dahinter…
Wie ist das denn zu verstehen?
Ich habe mir sehnlichst ein i-Phone gewünscht. Das kostete eine Menge Geld, und mein Vater schlug mir vor, dass ich mir das im Stall verdiene.
Mussten Sie da lange überlegen?
Nein, denn ich wollte so ein Ding unbedingt haben!
Ist das heute für Sie noch wichtig?
Nicht mehr so wie früher, dass ich es die ganze Zeit mit mir umhertragen und ständig rumzappen muss. Aber es ist schon hilfreich, so einen kleinen Computer dabei zu haben.
Milchtechnologin, Landwirtin und Arbeit in der Prignitz
Wie ging es nach dem Abitur für Sie weiter?
Ich habe eine Ausbildung als Milchtechnologin absolviert und in einer Molkerei in Aurich gearbeitet. Es hat mich fasziniert, mehr über die Verarbeitung dieses wichtigen Lebensmittels zu erfahren. Damit wuchs dann auch mein Interesse daran, wie Tiere zu halten und zu versorgen sind. Deshalb habe ich eine zweite Ausbildung als Landwirtin aufgenommen und in einem Betrieb in Ostfriesland gearbeitet. In dem wurde quasi von heute auf morgen der Bestand von 80 auf 400 Kühe aufgestockt. Das fand ich unglaublich aufregend.
Weil da alles komplett umgekrempelt wurde?
Genau. Da braucht es nicht nur neue Technik und Technologien, sondern auch ein völlig neues Herangehen. Alte Pfade zu verlassen ist so spannend! Ich konnte dabei sein und viel lernen!
Wie kam es aber, dass Sie letztendlich in der Prignitz gelandet sind?
Meine Eltern haben vor mehr als einem Dutzend Jahren einen Milchviehbetrieb in Meyenburg gekauft, weil das auch ein Schritt in Sachen Entwicklung war. Ich bin damals noch in Ostfriesland bei meiner Großmutter geblieben, weil ich zunächst in der Ausbildung war und dann dort meine Arbeit hatte. Irgendwann kam dann der Entschluss, auch in die Prignitz zu ziehen. Die ist längst mein Zuhause.
Den Menschen dort sagt man nach, dass sie sehr verschlossen sind.
Ach was. Ich habe das nicht so empfunden. Ist doch immer die Frage, wie man auf die Anderen zugeht und sich ihnen öffnet!
Milchkönigin aus Brandenburg: Vorstellung per Video
Damit haben Sie offensichtlich kein Problem. Sich für das Amt der Milchkönigin Brandenburgs zu bewerben war da wohl eine logische Konsequenz.
Überhaupt nicht. Auf die Idee bin nicht ich gekommen, sondern meine Mama. Ihr zuliebe habe ich mich beim Rinderzuchtverband beworben. Ich konnte aber nicht so richtig daran glauben, dass es klappt.
Waren denn die Fragen für Sie schwierig zu beantworten?
Nein, ich hatte nur ein bisschen damit zu tun, dass das Gespräch online, also per Video, geführt wurde. Klar, eine Vorsichtsmaßnahme, denn Corona war noch nicht ganz ausgestanden. Aber es ist schon komisch, sich auf diese Weise zu präsentieren. Bei einem direkten Kontakt kann man die Resonanz besser einschätzen und notfalls noch einen Gang zulegen.
Das war aber offensichtlich nicht nötig. Gab es mehrere Bewerberinnen?
Soweit ich weiß, waren wir zu zweit.

Was reizt Sie an dem Amt, das Sie seit fast zwei Jahren ausüben?
Dass man interessante Leute nicht nur aus der Politik, sondern auch aus anderen Bereichen kennenlernt. Und dass man im Gespräch Vorurteile gegenüber der Landwirtschaft abbauen kann. Denn die gibt es reichlich. Da ich aus einem Familienbetrieb komme, ist es mir besonders wichtig, Verständnis für unsere Situation zu wecken. Den zumeist katastrophalen Milchpreisen stehen immer heftigere Auflagen und bürokratische Hürden gegenüber. Dies zu kompensieren ist gerade für kleine Betriebe außerordentlich schwierig. Wir brauchen angemessene Preise für unsere Produkte!
Gab es auch weniger erfreuliche Momente Ihrer Amtszeit?
Nein, das kann ich nicht sagen. Gerade die diesjährige BraLa, die nach drei Jahren Pause endlich wieder stattfand, war ein großartiges Erlebnis. Es gab viele gute Gespräche, und besonderen Spaß hat es gemacht, die Preise an Jungzüchter zu übergeben. Auf der Grünen Woche zum Jahresanfang ging es da etwas förmlicher zu. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Entscheidung war, dort die unterschiedlichsten Königinnen hierzulande quasi im „Paket“ zu präsentieren. Das fühlte sich ein bisschen wie Schaulaufen an. Und bitte immer schön lächeln, um es den Fotografen recht zu machen. Aber auch in Berlin gab es viele Möglichkeiten, um auf aktuelle Probleme der Landwirtschaft aufmerksam zu machen.
Wie bewerten Sie die Debatte über das Tierwohl?
Die ist wichtig, keine Frage. Wobei ich dazu sagen muss, dass es unseren Kühen gutgeht. Sie sind den ganzen Sommer über draußen, ab Ostern geht es raus auf die angrenzende Weide und nur zum Melken in den Stall. Der bietet für die restliche Zeit des Jahres ausreichend Platz, ist allerdings in die Jahre gekommen. Wenn wir das Tierwohl verbessern und effizienter Milch produzieren wollen, müssen wir investieren. Daran führt kein Weg vorbei.
Studium an der Fachhochschule in Güstrow
Parallel zu Ihrer Arbeit im Betrieb der Eltern studieren Sie an der Fachschule in Güstrow. Wie lässt sich das vereinbaren?
Das Studium geht über drei Wintersemester, ich absolviere gerade das letzte. Am Wochenende und in der besonders arbeitsintensiven Zeit bin ich also vor Ort. Den Wechsel kriege ich ganz gut hin, weil ich mich im Stall und auf dem Feld ebenso wohlfühle wie im Hörsaal. In Güstrow gibt es tolle Dozenten, aber auch ein gutes Miteinander in der Seminargruppe. Die meisten von uns kommen ja aus der Praxis. Wir waren vor wenigen Wochen erst auf einer selbst organisierten Studienreise, haben unterschiedliche Betriebe besucht. Das gab viel Inspiration.

Steht Ihre Abschlussarbeit schon?
Ja, ich werde sie noch vor Weihnachten verteidigen. Ein bisschen zu schaffen macht mir noch die damit verbundene Power-Point-Präsentation. Für die muss ich mich auf wenige Seiten beschränken, doch die Arbeit umfasst insgesamt 50 Seiten. Den Inhalt so stark zu reduzieren ist nicht ganz einfach.
Wie lautet das Thema?
Es geht um die Erneuerung der Melktechnik in unserem Betrieb. Das Thema konnte ich selbst auswählen und habe mich deshalb für das Naheliegende entschieden. Im Kern geht es um die Frage, ob Melkroboter zum Einsatz kommen oder ein neuer Fischgrätenmelkstand eingebaut wird. Die Roboter brauchen mehr Platz und sind noch dazu teurer. Das hieße, dass der Stall noch erweitert werden müsste und zusätzliche Kosten entstehen. Und ob diese Technik wirklich effektiver im Vergleich zur Fischgräte ist, wage ich zu bezweifeln.
Was sagt Ihr Vater dazu?
Er ist auch skeptisch, zumal er einen Betrieb kennt, der vor Jahren Roboter erst an- und nun wieder abgeschafft hat. Aber Vater meint, dass ich dann die Entscheidung treffen soll, wenn es so weit ist.
Richtung Zukunft
Das heißt, dass Sie in ein paar Jahren den Familienbetrieb weiterführen werden?
Eins nach dem anderen. Erst geht es mir um einen guten Abschluss an der Fachschule im Sommer als staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin. Danach werde ich mich vor allem um das Herdenmanagement kümmern, um die Eltern zu entlasten. Papa kann sich wieder mehr um den Ackerbau kümmern und Mama um die Buchhaltung. Ich freue mich jedenfalls darauf. Und es ist denkbar, dass auch mein Freund bald in den Betrieb mit einsteigt. Dann sehen wir weiter.
Ihre zweite Amtszeit als Milchkönigin geht in wenigen Monaten zu Ende. Was geben Sie Ihrer Nachfolgerin mit auf den Weg?
Dass es ein phantastisches Amt ist und dass es sich lohnt, sich als Botschafterin für die Milch zu engagieren. Wer viel gibt, bekommt viel zurück!
Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Sie gehören zum Advent und zu Weihnachten wie Stollen und Lebkuchen – die Dominosteine. Doch hätten Sie gewusst, dass die süßen Köstlichkeiten eine Erfindung aus Dresden sind?
Von Bärbel Arlt
Die Wiege der Dominosteine steht in Dresden. Herbert Wendler, ein bekannter Chocolatier der Stadt an der Elbe, war es, der 1936 die heute weihnachtliche Süßigkeit erfand. Bereits drei Jahre zuvor hatte er, gerade mal 21 Jahre jung, seine eigene Pralinenmanufaktur gegründet. Und an seine Köstlichkeiten stellte der junge Unternehmer hohe Qualitätsansprüche.
Doch die Zutaten für seine Pralinen wurden in den Folgejahren immer teurer, weil auch immer rarer, und weite Kreise der Bevölkerung konnten sie sich schlichtweg nicht leisten. Es musste also eine Praline her, die für jedermann erschwinglich war und in großen Mengen produziert werden konnte. Wendler, für seinen Ehrgeiz bekannt, suchte nach einer Lösung – und die musste aber auf jeden Fall seinen Ansprüchen an Qualität, Geschmack und auch Optik gerecht werden. Nach vielen Versuchen war sie dann auch gefunden – mit dem Dominostein.

Unsere Top-Themen
• Deutsches Gelbvieh
• Seuchenalarm in Brandenburg
• Saatgut ernten
• Märkte und Preise
Dominostein Dresdener Original: Pulsnitzer Spitzen als Vorlage
Vorlage waren für den jungen Dresdner Chocolatier die von den Pfefferküchlern aus Pulsnitz hergestellten Spitzen – bestehend aus Lebkuchen, gefüllt mit Kirschgelee und mit Schokolade überzogen. Daraus entstand bei Wendler die Idee für eine Praline aus drei Schichten: brauner Lebkuchen als unterste Schicht, obendrauf Sauerkirschsaft-Gelee und abschließend weiches Marzipan, alles umhüllt mit Schokolade.
Und mit diesem Dominostein – ursprünglich auch als Notpraline bezeichnet, weil aus der Not heraus geboren – hatte Wendler den Zahn der Zeit getroffen. Die süß-würzigen Würfel mundeten und kamen bei den Menschen an, vor allem auch bei denen, für die Pralinen ansonsten zum Luxus gehörten. Und genau das wollte ja Chocolatier Herbert Wendler erreichen.
Kleine GEschichte des Dominosteins
Zwar ist Wendlers Erfindung inzwischen ein weltweit begehrtes süßes Erfolgsprodukt, doch er selbst erlebte nicht immer die Schokoladenseiten des Lebens. Seine Manufaktur wurde Ende des Zweiten Weltkrieges zerstört.
Es erfolgten Neubeginn und Wiederaufbau ab 1952. Doch schon 20 Jahre später, 1972, erging es seinem Betrieb wie Tausenden anderen in der DDR. Sie wurden enteignet und verstaatlicht. Wendler selbst wurde Direktor des VEB Elite Dauerbackwaren. Nach der Wende 1990 wagte er mit knapp 80 Jahren einen Neustart. Leider erfolglos. Sechs Jahre später muss er Insolvenz anmelden. 1998 stirbt er.
Doch zum Glück nahm er sein Rezept nicht mit ins Grab, sondern gab es in die Hände von Dr. Hartmut Quendt, dessen Unternehmen die Tradition fortführte und den Dominostein nach Original-Rezeptur noch immer herstellt – und das erfolgreich.

Dominostein-Cupcake: Rezept der Woche
Jetzt in der Bauernzeitung Ausgabe 48/2023 auf Seite 53 lesen.

Bauernzeitung:
- Kompaktes Fachwissen
- Einzelheft in der App verfügbar
- Milchkönigin in Gummistiefeln u. v. m.
Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Ob es nun Pfannkuchen, Berliner oder Krapfen genannt wird – das Hefegebäck darf zum Faschingsauftakt am 11.11. nicht fehlen. Doch nicht nur süß, auch herzhaft passt es durchaus zum fröhlichen Treiben.
Wer die Wahl hat, hat die Qual – schließlich gibt es den Pfannkuchen, wie das Schmalzgebäck vor allem im Osten Deutschlands und insbesondere in Berlin bezeichnet wird, in Bäckereien und Supermärkten mit den unterschiedlichsten Füllungen, Glasuren und Verzierungen. Doch Pfannkuchen gelingen durchaus auch in der eigenen Küche, wo man sie ganz nach dem eigenem Geschmack backen kann.

Unsere Top-Themen
• Deutsches Gelbvieh
• Seuchenalarm in Brandenburg
• Saatgut ernten
• Märkte und Preise
Pfannkuchen – Traditionell aus Hefeteig
Bekannt und beliebt sind natürlich vor allem die süßen Pfannkuchen. Traditionell werden sie aus einem Hefeteig zubereitet. Dafür siebt man Mehl in eine Schüssel und vermengt es mit Zucker, Hefe, etwas Salz und lauwarmer Milch, erklärt die Bundeszentrale für Ernährung.
Den Vorteig ruhen lassen und dann mit Eiern und handwarmer geschmolzener Butter zu einem glatten Teig verkneten. Auch den mindestens eine Stunde an einem warmen Ort gehen lassen. Dann wird das Frittier-Fett in einem hohen Topf auf eine Temperatur von rund 180 °C erhitzt. In der Hitze schließen sich die Poren schneller, und die Pfannkuchen saugen weniger Fett auf, so das Bundeszentrum für Ernährung.
Die Temperatur ist richtig, wenn an einem Holzlöffel kleine Bläschen aufsteigen. Die Pfannkuchen je nach gewünschter Größe formen und möglichst nochmals gehen lassen. Dann portionsweise in das heiße Öl geben. Die Pfannkuchen werden von beiden Seiten goldbraun ausgebacken und sind nach wenigen Minuten fertig. Ist genügend Platz im Topf, drehen sich die Teiglinge von selbst.
Nun die kross gebackenen Bällchen mit einem Schaumlöffel herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Wer mag, kann das Gebäck noch füllen. Das macht man am besten mithilfe einer Krapfen- oder Garnierspritze. Die noch warmen Pfannkuchen können dann je nach persönlicher Vorliebe in Streuzucker gewälzt, mit Puderzucker oder auch mit Zimtzucker bestreut werden.
Berliner, Pfannkuchen und Krapfen – Herzhaft?
Doch Pfannkuchen munden nicht nur als Süßspeise. Sie dürfen durchaus auch mal herzhaft sein. So lassen sie sich zum Beispiel mit Zwiebeln und Speck, die vorher geröstet werden sollten, füllen. Dazu schmeckt Sauerkraut.

Auch mit Käse und Schinken, gekocht oder roh, lassen sich Pfannkuchen zubereiten. Dafür am besten geriebenen Emmentaler verwenden. Käse und Schinken werden gleich mit dem Hefeteig verknetet und dann im Backofen ausgebacken. Natürlich eignen sich auch Kräuter und Gewürze wunderbar für einen närrischen Pfannkuchen. Den herzhaften Zutaten sind wahrlich keine Grenzen gesetzt.
Bezeichnung variiert
Apropos närrisch. Nicht nur die Bezeichnungen für den in Fett ausgebackenen Pfannkuchen sind regional unterschiedlich. Auch Eierkuchen, Crêpes oder Pancakes werden je nach Region mitunter als Pfannkuchen bezeichnet.
Doch egal ob nun der Pfannkuchen ein Berliner ist oder der Eierkuchen ein Pfannkuchen – Hauptsache er schmeckt gut und passt zu einer ausgelassenen Faschingsparty. (red)

Grüne Pfannkuchen mit Limettenbutter: Rezept der Woche
Jetzt in der Bauernzeitung Ausgabe 45/2023 auf Seite 64 lesen.
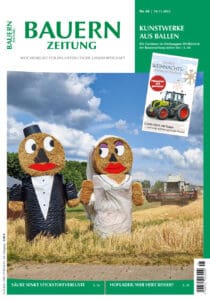
Bauernzeitung:
- Kompaktes Fachwissen
- Einzelheft in der App verfügbar
- Hoflader im Test Teil 2, Kunst aus Ballen u. v. m.
Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Das geplante Landes-Klimaschutzgesetz, auch wenn die Erstellung im zeitlichen Verzug ist, und seine Auswirkungen verunsichern die Branche.
Es ist ein Schreckgespenst, das seit rund einem Jahr durch die Branche geistert. Und auch in der vergangenen Woche war es vielerorts das zentrale Thema. Die Rede ist vom Landes-Klimaschutzgesetz.
Denn nachdem SPD und Linke bei der Regierungsbildung vor zwei Jahren als zentrales Projekt ausriefen, der Nordosten soll bis 2040 klimaneutral werden, lautete der Auftrag in Ministerialsprache: „Erarbeitung und Umsetzung eines Klimaschutzgesetzes für MV in einem breiten Dialogprozess mit dem Ziel, Netto-Treibhausgasneutralität bis spätestens 2040 zu erreichen.“ In der Landtagssitzung im Dezember 2022 kündigte der zuständige Minister Till Backhaus dann an, dass das Gesetz absolute Priorität habe und der entsprechende Entwurf dem Parlament im Jahr 2023 vorgelegt werde.

Unsere Top-Themen
• Deutsches Gelbvieh
• Seuchenalarm in Brandenburg
• Saatgut ernten
• Märkte und Preise
Landes-Klimaschutzgesetz MV: Zeitverzug
Doch dazu wird es nicht mehr kommen, wie mittlerweile bekannt ist. Backhaus räumte in der vergangenen Landtagssitzung Zeitverzug ein. Seinen Aussagen zufolge komme es in diesem Jahr noch zur Ressort-Anhörung, nicht jedoch zum fertigen Gesetzentwurf. Als Grund nannte er noch fehlende Festlegungen des Klimaschutzgesetzes des Bundes, vor allem die sogenannten Sektorziele seien nicht klar.
Den zeitlichen Verzug – und die Übergabe an den Landtag frühestens im Juni 2024 – bestätigte auch Dr. Karsten Bugiel, Referatsleiter im Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt, am Dienstag voriger Woche in Greifswald.
Bei der 5. Gesprächsrunde zum Energie-, Umwelt- und Seerecht stellte der Referatsleiter den aktuellen Stand des Gesetzentwurfs vor. Zudem zeigte er gleich zu Beginn seiner Ausführungen auf – was sich nicht nur einige Landwirte bereits dachten –, dass es keine verfassungsrechtliche Pflicht zum Erlass von Landesklimaschutzgesetzen gibt. Er betonte jedoch, dass ohne eigene Durchführungsmaßnahmen und Gesetzgebung in den Ländern die internationalen, europäischen und nationalen Klimaschutzziele nicht zu erreichen sind.
Auswirkung auf die Agrarbranche
Mit Blick auf die Agrarbranche ist bedeutend, dass der vorgestellte Entwurf eine Rangfolge vorsieht, wie die Treibhausgasreduzierung erreicht werden soll. Nachdem Treibhausgasemissionen in den verschiedensten Bereichen vermieden, vermindert sowie Effizienzpotenziale und regenerative Alternativen genutzt werden sollen, geht es an die Flächen. Zunächst sollen generell Flächen mehrfachgenutzt werden.
Zum Ausgleich der Emissionen soll zudem die Senkenfunktion der Wälder und Moore ausgebaut werden. Dafür sollen bis 2040 die Entwässerung von Mooren eingestellt und die Waldfläche um jährlich 1.000 ha erhöht werden. Dass die Sektoren Landwirtschaft sowie Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) die vielversprechendsten Minderungspfade seien, untermauerte die von Matthias Reichmuth, Geschäftsführer des Leipziger Instituts für Energie GmbH, vorgestellte Sektorzielstudie.
Auch interessant

Das Gespräch frühzeitig mit Betroffenen suchen
Und was sagen die betroffenen Flächenbesitzer dazu? In Greifswald selbst gab Dr. Manfred Leberecht, Mutterkuhhalter und Vizepräsident des Landesbauernverbandes, zu bedenken, dass Moorstandorte auch wichtige Futtergrundlagen sind. Fallen sie aus der Produktion, werde vielen Rinderhaltern im Land wirtschaftlich das Rückgrat gebrochen.
Bei einem fast zeitgleich stattfindenden Forum in Loitz überschlug der Geschäftsführer des Bauernverbandes, Dr. Martin Piehl, im Beisein des Ministers die Zahlen: Bei rund 250.000 ha, die aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu fallen drohen, betreffe das etwa 1.000 Betriebe – „da wird mir angst und bange.“

Der ebenfalls dort anwesende Geschäftsführer der Trantower Agrar GmbH, Carsten Stegelmann, nahm es bei aller Brisanz fast sportlich und beschrieb, dass sich die Landwirtschaft seit Jahrzehnten ständig wandelt und innovativer wird. Er wünsche sich, dass bei solch einschneidenden Vorhaben frühzeitig das Gespräch mit den Betroffenen gesucht werde.
Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Sie feiern in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen – die Berliner Stadtgüter. Einst mit der Kanalisation der aufstrebenden Metropole Berlin entstanden, sind sie heute vor den Toren der Hauptstadt und damit in Brandenburg Erholungsort, Biotop, Acker für Landwirte und sorgen für grüne Energie.
Es ist ein diesiger Herbsttag mit leichtem Nieselregen – irgendwie passend für einen Recherchetermin auf dem stillgelegten Rieselfeld bei Großbeeren, einem der ältesten, die rund um Berlin im 19. Jahrhundert angelegt wurden.
Über 100 Jahre – von 1881 bis 1996 – verrieselten hier die Abwässer der Metropole. In Spitzenzeiten sollen es täglich 52.000 m3 gewesen sein. Doch wie kam es eigentlich dazu?

Unsere Top-Themen
• Deutsches Gelbvieh
• Seuchenalarm in Brandenburg
• Saatgut ernten
• Märkte und Preise
Berliner Stadtgüter 150 Jahre: Ein Blick in die Geschichte
Begonnen hatte alles mit der rasanten industriellen Entwicklung Berlins im 19. Jahrhundert. Damit verbunden war ein Ansturm von Menschen, die hier arbeiten und leben wollten. Doch die Bevölkerungsexplosion überforderte die Stadt, führte zu Armut und Elend. Arbeiter und Familien – sie lebten in heute unvorstellbaren prekären hygienischen Verhältnissen. Fäkalien wurden auf Straßen und in Rinnsteinen entsorgt, was wiederholt zu Infektionskrankheiten wie Cholera, Tuberkulose, Typhus führte.
Es musste sich also dringend etwas ändern. Doch damals wie heute wurde langwierig um Lösungen gerungen. Es wurde gestritten, diskutiert, abgelehnt, Ängste wurden geschürt. Der Fortschritt hat es eben nie leicht, sich durchzusetzen. Doch 1873 beschloss die Berliner Stadtverordnetenversammlung dann doch den Bau eines Abwasserentsorgungssystems, das zugleich auch die Geburtsstunde der Berliner Stadtgüter ist.
Abwasser-Revolution von James Hobrecht
Nach Plänen von Stadtplaner James Hobrecht entstand fortan ein gigantisches unterirdisches Kanalsystem, in dem die Abwässer gesammelt und über radial angeordnete Pumpsysteme auf die außerstädtischen Rieselfelder geleitet, dort gereinigt und verrieselt wurden. Natürlich stank es zum Himmel.
Doch dieses ausgeklügelte Abwassersystem war eine technische Revolution. Es machte Berlin Ende des 19. Jahrhunderts zu einer der saubersten Städte und zu einem Vorbild für andere Metropolen und das sogar weltweit. So interessierten sich zum Beispiel Moskau, Tokio und Kairo beim Bau eigener Entwässerungssysteme für das Berliner Kanalisationsmodell.

Dünger für die Landwirtschaft
Von großem Nutzen wurden die Rieselfelder auch für die heimische Landwirtschaft, waren doch die Abwasserreste begehrter Dünger und die Rieselflächen selbst attraktive Ackerflächen, auf denen Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Kartoffeln, Kohl, Gurken und Obst geerntet wurden.
Auf den zahlreichen Stadtgütern rund um Berlin, die neben den Rieselfeldern noch Tausende Hektar landwirtschaftlicher Flächen besaßen, wurden Kühe, Schweine, Schafe und Hühner gehalten. Aber es gab – und das mit der weiteren Entwicklung von Industrie und Landwirtschaft – auch unerwünschte Nebeneffekte durch Schwermetalle und organische Schadstoffe. „So können heute von den rund 5.500 Hektar stillgelegter Rieselfelder etwa 2.000 Hektar nur eingeschränkt landwirtschaftlich genutzt werden“, sagt Katrin Stary, studierte Geodätin und seit 2015 Geschäftsführerin der Berliner Stadtgüter.


Zu den erhaltenen Rieselfeldern gehört auch das in Großbeeren, heute ein technisches Denkmal. Ein zwei Kilometer langer Pfad führt entlang erhaltener Bauwerke wie Standrohr, Absetzbecken, Grabenzuläufe, Schieber und Durchlässe, die einst ein Rieselfeld prägten. Und während wir daran vorbeispazieren, erzählt Katrin Stary von den Höhen und Tiefen, die die Berliner Stadtgüter in ihrer 150-jährigen Geschichte durchlaufen mussten.

Berliner Stadtgüter – Schwierige Zeiten
Da ist die Rede von den schwierigen Anfangsjahren, von der Schaffung von Arbeitsplätzen, Wohnungen und Gütern, von der Erzeugung von Lebensmitteln für die Versorgung der Berliner Bevölkerung, von den Zwangsarbeitern, die im Zweiten Weltkrieg auf den Flächen schuften mussten, von der Bildung der Volkseigenen Güter zu DDR-Zeiten und vom schwierigen Prozess der Eigentumsverhältnisse, Rückübertragungen und Entschädigungen nach der Wende 1990 sowie vom Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft – einhergehend mit der Entlassung von Mitarbeitern.
In den Jahren folgten dann weitere Umstrukturierungen, Neuausrichtungen, Privatisierungen. Doch trotz aller Herausforderungen und Reformierungen – die Berliner Stadtgüter haben jede schwierige Zeit überlebt, wenn auch die Existenz so manches Mal auf dem Spiel stand. „Wir sind nicht nur da, sondern wir sind auch erfolgreich da und schreiben verlässlich schwarze Zahlen“, sagt Katrin Stary.
Von Verpachtung bis Erlebniswiesen
Nach wie vor spielt die Landwirtschaft eine große Rolle im Kerngeschäft des landeseigenen Unternehmens, zu dem 17.000 ha Fläche im Land Brandenburg gehören, wovon 85 % an Landwirte verpachtet werden – und auf denen, man staune, inzwischen sogar Reis wächst.
Verändert haben sich allerdings die Aufgaben der Berliner Stadtgüter. „Wir sind zwar Eigentümer der Flächen, verpachten diese aber an private Landwirte“, und das, so versichert die Stadtgüterchefin, langfristig und zu fairen Preisen. Weitere wichtige Geschäftsfelder sind die Sanierung, Pflege und Renaturierung stillgelegter Rieselfelder. Die Stadtgüter sind Partner für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, schaffen Biotope und Erholungsorte.
Als Beispiele nennt Katrin Stary die Wildobstallee in Deutsch-Wusterhausen, den Löwenzahnpfad bei Schönerlinde, wo sich Wasserbüffel und Konikpferde wohlfühlen, und die Erlebniswiese Mauerbienchen am ehemaligen Mauerstreifen in Großziethen nahe der Berliner Gropiusstadt. Auch Umweltbildung spielt eine große Role. So werden zum Beispiel gemeinsam mit Schülern die Früchte der Streuobstwiesen geerntet und direkt vor Ort gepresst.

Agri-PV-Anlage am Flughafen-BER
Und schließlich sorgen die Stadtgüter auf ihren Freiflächen für grünen Strom – mit derzeit 45 Windrädern, 120 ha Kurzumtriebsplantagen und drei großen Solaranlagen mit einer installierten Leistung von 35, 80 MWp (Megawattpeak). Katrin Stary verweist in dem Zusammenhang auf eine 70 ha große Agri-PV-Anlage, die derzeit auf Flächen der Berliner Stadtgüter am Rande des Großflughafens BER geplant wird. Knapp 85 % der Flächen sollen dort für die landwirtschaftliche Nutzung erhalten bleiben.

Berliner Stadtgüter 150 Jahre – Online
Die spannende 150-jährige Geschichte der Berliner Stadtgüter zeigt eindrucksvoll eine virtuelle, multimediale und sehr interessante Ausstellung mit historischen Fotos, Dokumenten und Hörstücken fiktiver Zeitzeugen: geschichte-berlinerstadtgueter.de
Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Der Betriebsleiter der Raunitzer Agrar GmbH ist mit 20 Leicoma-Schweinen zur Insel Amrum unterwegs als Reserve für den ASP-Fall. Der Betrieb aus Sachsen-Anhalt verkauft jetzt auch bei Edeka in Sachsen. Die Wurst vom Leicoma gibt es außerdem Online und in Direktvermarktung.
Der Mitte November 2023 avisierte Besuch unseres Praxispartners in Gimritz musste kurzfristig umdisponiert werden. Betriebsleiter Wouter Uwland war zu diesem Zeitpunkt mit dem VW Crafter samt Viehhänger in Richtung Nordfriesland unterwegs.
Der 39-Jährige hatte rund 20 Leicoma-Schweine geladen, um sie zu einem Berufskollegen auf die Insel Amrum zu bringen. „Wir haben Anfang der Woche aus unserem Bestand einige herdbuchtaugliche Jungsauen selektiert“, sagte der Züchter am Telefon. Hinzu kam eine Handvoll männlicher Kastraten für die Weitermast, die „an den Haken“ kommen sollen, sobald sie ihr Schlachtgewicht erreicht haben.
„Die weiblichen Zuchttiere sind als Reservepopulation für unsere Leicoma gedacht“, erklärte Uwland unter Verweis auf die weiterhin bestehende Gefahr durch die Afrikanische Schweinepest. Quasi eine Rückgriffsmöglichkeit für den Tierseuchenfall.

Unsere Top-Themen
• Deutsches Gelbvieh
• Seuchenalarm in Brandenburg
• Saatgut ernten
• Märkte und Preise
Raunitzer Agrar GmbH in Amrum: Ackerbauern mit Hofladen
Uwland hofft, dass er diese „Versicherung“ nicht brauchen wird. Wenn möglich, würde er den Hof auf der Insel gern kontinuierlich beliefern. Irk Martinen und sein Sohn Oke sind die letzten Ackerbauern auf Amrum. Die beiden Männer bewirtschaften gut 190 ha – die Hälfte des Ackerlandes der Insel – und halten rund 100 Mastrinder sowie 200 Legehennen im Mobilstall.
Einen alten Stall hat die Familie, die in vierter Generation Landwirtschaft betreibt, zum Hofladen umfunktioniert. Dort bietet Birgit Martinen jetzt ihre Produkte an, unter anderem Fleisch der eigenen Rinder.

Leicoma-Schweinefleisch bei Edeka
Einen neuen Abnehmer für seine Schlachtschweine hat Wouter Uwland in Sachsen gefunden, berichtete der umtriebige Unternehmer aus dem Saalekreis. Edeka-Händler Peter Simmel, der 20 Filialen im Freistaat und in Thüringen sowie vier in Bayern betreibt, will in seinen Märkten vor allem Frischfleisch der Leicoma-Schweine vermarkten.
Geschlachtet und grob zerlegt werden die Tiere in der Großschlächterei Emil Färber in Belgern-Schildau im Landkreis Nordsachsen. Die Feinzerlegung erfolgt dann in den Edeka-Märkten. Zunächst sei eine Belieferung des Schlachthofes mit wöchentlich etwa 40 Schweinen vereinbart, der Betriebsleiter. Gegebenenfalls könne diese Menge auf 50–55 Tiere wachsen. Für den Gimritzer Landwirt bedeutet das, die betriebliche Produktion an Schlachttieren anzukurbeln, um die größere Nachfragebedienen zu können.
Direktvermarktung: Wurstwaren vom Leicoma-Schwein
Für den Züchter bietet der zweite Vermarktungsweg neben der Belieferung der vertraglich gebundenen Metzgereien mit Schlachtschweinehälften ein Plus an Sicherheit. Denn die Kaufzurückhaltung der Kunden aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen macht auch vor den handwerklich organisierten Fleischverarbeitungsbetrieben nicht Halt.
Ins Sortiment der Edeka-Märkte aufgenommen werden sollen auch Wurstwaren vom Leicoma. Dafür und für die eigene Direktvermarktung im Hofladen sowie perspektivisch für den Online-Shop und weitere Geschäfte anderer Betreiber gibt es neue Gläser, in denen Bockwurst, Wiener Würstchen sowie Hausmacher-Leber-, Blut-, Mett- und Jagdwurst angeboten werden.

ISS GUT!-Messe in Leipzig
Mit einem kleinen Stand präsent war der Gimritzer Betrieb samt seinen Erzeugnissen Anfang November auf der „ISS GUT!“ in Leipzig, der führenden Fachmesse für Gastgewerbe und Ernährungshandwerk im Osten Deutschlands. „Ob sich daraus etwas Zählbares für uns ergibt, wird sich zeigen“, gab sich Wouter Uwland verhalten optimistisch zum Auftritt auf dem Marktplatz für regionale Produkte. Aussteller aus den Bereichen Feinkost, Kaffee, Spirituosen, Wurst- und Fleischwaren sowie Wein waren an den drei Tagen vor Ort, um ihre Produkte und Ideen dem interessierten Fachpublikum zu präsentieren.
Zielgruppe sind laut der veranstaltenden Messe GmbH Gastronomen, Hoteliers und Unternehmen der Gemeinschaftsverpflegung, das Ernährungshandwerk mit Bäckern, Konditoren und Fleischern, Caterer, Handel und Großhandel sowie Planer und Imbiss-Anbieter. An der Messe, die alle zwei Jahre stattfindet, beteiligten sich 251 Aussteller aus neun Ländern, 9.200 Besucher kamen.
Regionalvermarkter des Jahres
Weitere Termine standen diese Woche ins Haus: Donnerstagabend, den 16. November 2023, wurden im Naumburger Ortsteil Henne die besten Direktvermarkter/-innen Sachsen-Anhalts prämiert. Die Galaveranstaltung mit Ehrung der Besten bildete den Abschluss des Wettbewerbes „Regionalvermarkter des Jahres“, an dem sich Caroliene Uwland mit ihrem Hofladen beteiligte.
Wie die Agrarmarketinggesellschaft (AMG) vorab mitteilte, verfüge die hiesige Ernährungswirtschaft nicht nur über international erfolgreiche „Flaggschiffe“, sondern beheimate auch zahlreiche kleine, aber feine Erzeuger von Lebensmitteln in herausragender Qualität. Diese würden nicht selten als „Geheimtipp“ von Kunde zu Kunde getragen. Um sie ins Rampenlicht zu stellen, sei in diesem Jahr erstmals der Wettbewerb durchgeführt worden.
Weiterbildung Direktvermarktung und Spezialitäten aus Gimritz
An diesem Freitag, den 24. November 2023, findet auf dem Bauernhof der Familie Saudhof in Nelben bei Könnern eine Veranstaltung der Reihe „Praktiker für Praktiker“ im Rahmen der Weiterbildung für Direktvermarkter statt. Der wird von der Agrarmarketinggesellschaft in enger Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) organisiert.
Im Hofladen von Caroliene Uwland läuft derweil schon seit geraumer Zeit das Vorweihnachtsgeschäft. Wer neben dem eigenen Einkauf für die Festtage auch Freunde, Mitarbeiter oder Geschäftspartner mit Käse-, Wurst- und anderen Spezialitäten aus Gimritz bedenken möchte, kann vor Ort im Laden oder per Mail bzw. Telefon weihnachtliche Präsentpakete zum Verschenken bestellen: bestellung@leicoma.de oder Tel. 01525 2169345.
Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Auf das Karlsruher Urteil zum Klimafonds folgte umgehend eine Ausgabensperre. Von ihr sind auch die Schlüsselprojekte des Landwirtschaftsministeriums betroffen.
Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Umschichtung ungenutzter Corona-Reserven in den Klima-und Transformationsfonds (KTF) für grundgesetzwidrig erklärt hat, stehen auch im Etat des Bundeslandwirtschaftsministeriums vermutlich weitreichende Kürzungen an. Nach den zu Wochenanfang vorliegenden Informationen werden vor allem die Förderprogramme im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) in Mitleidenschaft gezogen.
Der Deutsche Bauernverband (DBV) mahnte umgehend an, dass alle bereits begonnenen und konkret geplanten Maßnahmen fortgesetzt werden müssten. Alarmiert reagierten die Waldeigentümer (AGDW). Die beteiligten Ministerien müssen nun dringend gemeinsam eine Finanzierungslösung suchen, um die Förderung der Wiederaufforstung zu sichern.

Unsere Top-Themen
• Deutsches Gelbvieh
• Seuchenalarm in Brandenburg
• Saatgut ernten
• Märkte und Preise
Ausgabensperre im Bundeshaushalt und die Folgen
Die von Bundesfinanzminister Christian Lindner nach dem Karlsruher Urteil verhängte Ausgabensperre für den KTF betrifft neben den 120 Mio.€ zur Förderung der Wiederaufforstung von Kalamitätsflächen im Rahmen der GAK auch 80 Mio.€ für ein Förderprogramm zugunsten von Kleinwaldbesitzern. Diese Mittel sollten aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz kommen, das wiederum aus dem KTF gespeist werden sollte. Fraglich sind damit auch die Maßnahmen zur Wiedervernässung von Mooren. Dafür sollten aus dem ANK 1 Mrd.€ zur Verfügung gestellt werden.
Am Dienstag, den 14. November 2023, stellte das Finanzministerium klar, dass für das laufende Jahr keine Ausgabensperre besteht, eingeplante Mittel also abgerufen werden können. Bestehende Verbindlichkeiten würden eingehalten. Vorerst dürfen aber keine neuen Verpflichtungsermächtigungen für mehrjährige Vorhaben eingegangen werden, „um weitere Vorbelastungen für kommende Haushaltsjahre zu vermeiden“, wie es hieß. Betroffen sind die Einzelpläne aller Bundesministerien, ausgenommen nur die Verfassungsorgane wie der Bundestag.
Fehlende 60 Milliarden Euro
Insgesamt fehlen dem KTF nach dem Karlsruher Urteil 60 Mrd.€, die größtenteils verplant sind. Betroffen sind davon auch industrielle Ansiedlungen in Ostdeutschland, etwa die geplante Chipfabrik in Sachsen-Anhalt. Die Bundesregierung hat die Mittel, die nicht wie vorgesehen zur Bewältigung der Corona-Krise in Anspruch genommen worden waren, umgewidmet und über einen Nachtragshaushalt dem heutigen Klima- und Transformationsfonds zugeordnet. Dagegen gab es verfassungsrechtliche Bedenken, unter anderem vom Bundesrechnungshof. Knapp 200 Abgeordnete von CDU und CSU klagten vor dem Bundesverfassungsgericht. Ihrer Beschwerde gaben die Karlsruher Richter statt.
Am Dienstag hörte der Haushaltsausschuss des Bundestages Sachverständige nach ihrer Einschätzung an, ob trotz des Urteils der Haushalt für 2024 beschlossen werden kann. Davon hinge auch ab, ob die zuletzt teilweise zurückgenommenen Kürzungen an der Gemeinschaftsaufgabe (GAK) überhaupt wirksam werden können. Die Experten waren sich nicht einig. Die abschließenden Haushaltsberatungen wurden erst einmal verschoben. (red/AGE)
Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Das Bundesverfassungsgericht hat die Umschichtung von Corona-Reserven in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) für grundgesetzwidrig erklärt, wodurch 60 Milliarden Euro fehlen. Die verhängte Haushaltssperre lässt auch längerfristige Vorhaben auf der Kippe. Tierhalter könnten das zu spüren bekommen, kommentiert Ralf Stephan.
Geradezu Schlange stehen die Fragen, die man hier jetzt dringend tiefgründiger beleuchten müsste. Nachzubohren wäre zum Beispiel, warum Mitglieder dieser Bundesregierung die Erkenntnisse der mit Steuergeldern gut aufgestellten EU-Gesundheitsbehörde Efsa öffentlich in Zweifel ziehen, wenn es um die verlängerte Zulassung eines Herbizidwirkstoffs geht. Gleichzeitig müsste man sich eingehender damit beschäftigen, wie sich der Deutsche Bauernverband ab 2027 eine Gemeinsame Agrarpolitik ohne Direktzahlungen vorstellt.
Nicht minder spannend ist die Frage, wie schon bald das drittgrößte Land Europas, die Ukraine, in die EU aufgenommen werden und in diese GAP integriert werden soll. Das alles wird aber in dieser Woche in den Schatten gestellt von einem Ereignis, dessen Wirkung für den Bundeshaushalt manche mit einem Meteoriteneinschlag vergleichen.

Unsere Top-Themen
• Deutsches Gelbvieh
• Seuchenalarm in Brandenburg
• Saatgut ernten
• Märkte und Preise
Haushaltssperre 2023: Was auf der Kippe steht
Plötzlich fehlen 60 Milliarden Euro, weil das Bundesverfassungsgericht die Umschichtung von Corona-Reserven in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) für grundgesetzwidrig erklärt. Die erste direkte Reaktion des Finanzministers darauf ist richtigerweise eine Haushaltssperre. Sie betrifft zwar keine laufenden Posten. Aber sogenannte Verpflichtungsermächtigungen dürfen ab sofort nicht mehr neu ausgestellt werden.
Gemeint sind damit verbindliche Zusagen für Vorhaben, die über mehrere Jahre laufen. Und somit wären nach Lage der Dinge nicht nur solche Maßnahmen und Investitionen betroffen, die direkt aus dem – nach dem Urteil nun leeren – KTF bezahlt werden sollten. Denn Geld, das für die Sanierung der Bahn, für die Chipfabrik auf Bördeboden, aber auch für die Wiedervernässungsprogramme zum Klimaschutz ausgegeben werden sollte – es ist einfach nicht mehr da.
Aber ohne Verpflichtungsermächtigungen stehen auch die längerfristigen Maßnahmen, die aus dem „normalen“ Haushalt finanziert werden sollten, auf der Kippe. Zum einen, weil es im Moment noch keine Zusagen dafür gibt. Zum anderen aber, weil nicht sicher ist, ob sie die nächsten Haushaltsberatungen überhaupt überleben werden. Noch scheint nicht einmal festzustehen, ob der in den letzten Zügen debattierte Bundeshaushalt für 2024 überhaupt verabschiedet werden kann.
Tierwohl-Milliarde: Sparen bis es quietscht?
Um an Zukunftsprojekten zu retten, was zu retten ist, werden nun vielleicht nicht alle, aber sicher die meisten Bundesministerien sparen müssen. Und zwar, wie Berliner aus der Wowereit-Zeit wissen, bis es quietscht. Vor allem Tierhalter, die den tierwohlgerechten Umbau ihrer Ställe auf dem Plan haben, könnten das zu spüren bekommen.
Denn selbst hinter der für 2024 angekündigten ersten Rate von 150 Mio.€ aus der versprochenen Tierwohl-Milliarde steht auf einmal ein Fragezeichen – obwohl sie gar kein frisches Geld sind, sondern trickreich aus der GAK herausgekürzt wurden. Ein klassischer Fall für Verpflichtungsermächtigungen wären dagegen die später geplanten Zuschüsse zu den laufenden Mehrkosten für kleinere Betriebe.
Ob Cem Özdemir tatsächlich der erste Minister sein wird, der eine Milliarde für mehr Tierwohl herausgeholt hat, wie er gern betont, steht nach dem Meteoriteneinschlag vorerst in den Sternen. Fällt die Tierwohl-Milliarde Sparzwängen zum Opfer, wäre das schlecht für ihn. Aber viel härter träfe
es die Tierhalter. Denn wenn an einem nicht gespart wird, dann sind es vermutlich die Auflagen, die ihnen dann ohne den zugesagten finanziellen Beistand hinterlassen werden.
Kommentar aus der Ausgabe 47/2023
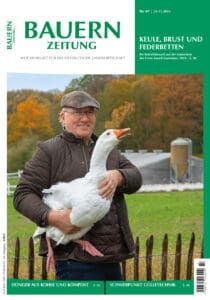
Top Themen:
- Schwerpunkt Gülletechnik
- Ausgabensperre im Bundeshaushalt
- Interview: Ceres-Award-Gewinner 2023
- Einzelheft ohne Abo in der App verfügbar
Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!
Auch interessant

Als Landwirt ist der Thüringer Friedrich Dübner sowohl im Haupt- als auch im Nebenerwerb tätig. Mit dem Abbau des Kuhbestands im Familienbetrieb verbesserte sich die Futtersituation der Schafe.
von Birgitt Schunk
Friedrich Dübners Schafherde ist bunt gemischt. Hier haben Rhönschafe, Coburger Füchse und Berrichon du Cher ihren Platz. 220 Muttertiere sind es, hinzu kommen 30 Burenziegen. Über Jahre hinweg baute der Nebenerwerbslandwirt aus Mühlberg im Landkreis Gotha seine Herde langsam auf. Die ersten Ziegen bekam er zur Schuleinführung geschenkt, später auch ein paar Rhönschafe, die ihm und seinem Vater optisch besonders gefielen.
„Doch wir bekamen die Rhönschaflämmer immer schlecht los“, sagt Dübner. „Deshalb suchten wir uns eine Fleischrasse, die von der Größe passt und uns bei der Gebrauchskreuzung keine Probleme mit Schwergeburten bringt.“ Die Wahl fiel auf die französischen Berrichon du Cher. Auch deren recht feine Wolle war ein weiterer Grund.
Bei den Rhönschafen gab es hier ebenfalls Absatzprobleme, obgleich sie verschmutzte Wolle bereits immer heraussortieren. Die minderwertigeren Qualitäten kommen als Dünger auf die Ackerflächen. „Ohne eine solche Verwendungsmöglichkeit im Feldbau würden nur die Anlieferung auf die Deponie und Entsorgungskosten für die Schafwolle bleiben.“

Unsere Top-Themen
• Deutsches Gelbvieh
• Seuchenalarm in Brandenburg
• Saatgut ernten
• Märkte und Preise
Mutterkühe sind keine Alternative
Der Bauer im Nebenerwerb, der mit Schafen und Ziegen 20 ha Grünland bewirtschaftet, ist auch hauptberuflich als Landwirt tätig. Im Betrieb seines Vaters, der aktuell noch 35 melkende Kühe hält und Feldbau betreibt, ist er angestellt. Die Grenzen zwischen Haupt- und Nebenerwerb sind fließend.
Vater und Sohn hatten entschieden, nicht weiter in die Milch zu investieren und den Kuhbestand herunterzufahren. Als Alternative konnten sich die beiden nicht für Mutterkühe erwärmen. „Hier ist das Handling schwieriger, die Schafhaltung kann ich allein bewerkstelligen“, sagt Dübner-Junior. Mit dem Kuhbestandsabbau war schließlich auch mehr Silage für die Schafe übrig.
Seit knapp sechs Jahren setzt der 37-Jährige ohnehin nur auf Heu plus Luzerne- oder Grassilage. Die Milch für die Lämmerkommt aus dem Grundfutter. Das spart Dübner zufolge nicht nur Ausgaben fürs Kraftfutter, sondern sorgt auch für mehr Ruhe im Stall im Winter: „Wenn wir sonst mit dem Eimer voll Kraftfutter kamen, begann die Hektik, weil die Schafe darauf fixiert waren.“
Der verstärkte Anbau von Futter auf Flächen des Haupterwerbsbetriebes, das für die Schafhaltung bereitgestellt wird, soll die Unabhängigkeit vom Markt stärken. „Wir müssen unsere Ernte nicht wegfahren und dann wieder Futter teuer einkaufen.“ Die Lämmer bekommen aber weiter Kraftfutterpellets, die der Betrieb bezieht. Mit Blick aufs Lämmerfutter wurden schon eigene Versuche unternommen, weil Getreidequetsche und Schrotmühle vorhanden sind. „Mit gequetschten Erbsen und Hafer haben wir experimentiert, die homogene, passgenaue Mischung aber nicht hinbekommen.“ Das Thema soll dennoch nicht aus den Augen verloren werden.

Schur und Klauenpflege in Eigenleistung
Friedrich Dübner war es wichtig, die Schafe im Nebenerwerb zu halten und den Zweig nicht in den Hauptbetrieb des Vaters, der als Wiedereinrichter begann, zu integrieren. „Die Sparte musste erst einmal für sich stehen, um genau zu sehen, was sie abwirft oder auch nicht.“ 2016 meldete der gelernte Landwirt den Nebenerwerb an. In die Karten spielt ihm seither, dass er die Schafschur selbst erledigt. Von „alten Hasen“ hat er sich dies abgeschaut. Bereits in der Lehrzeit schaffte er sich eine kleine Schermaschine an, später eine größere. 300 bis 400 Schafe erleichterte er pro Saison von ihrer Wolle, war so auch für andere Halter tätig. Dies hat er aber zurückgefahren, denn auf dem eigenen Hof gibt es genug zu tun.
Im November kommen die Tiere in den Stall, weil dann die Lammzeit beginnt, um zu Ostern das Fleisch vermarkten zu können. Vor dem Ablammen wird geschoren. „Wenn die Tiere reinkommen, ist das Vlies sauber. Das erleichtert das Scheren“, sagt Dübner. Da er all das selbst besorge, sei er unabhängig, könne zeitlich individuell planen. Auch die Klauenpflege erledigt er mit einem eigenen Behandlungsstand. Das macht ihn flexibel.
Die Familie hilft mit
Die Kosten für diese Dienstleistungen werden gespart – aber nur auf den ersten Blick. „Der Aufwand ist dementsprechend hoch, die Zahl meiner Arbeitsstunden auch. Würde ich mir den Stundenlohn hierfür aus dem Nebenerwerbsbetrieb rausnehmen, wäre der längst pleite.“ Frau und Familie helfen ohnehin mit – „sonst würde das alles erst recht nicht funktionieren“.
Ziel ist es perspektivisch für den Landwirt, die Synergieeffekte aus Neben- und Haupterwerb weiter auszubauen und den Kreislauf rund zu machen. Verstärkt sollen auf dem Acker künftig Zwischenfrüchte als Futter wachsen. Das Milchvieh wird im elterlichen Betrieb keine Zukunft haben, sind die Dübners überzeugt.
Wenn der Junior den Hof übernimmt, wird er irgendwann die Schafe in den Haupterwerbshof integrieren. Sie werden die Kühe ganz ablösen. In Verbindung mit dem Ackerbau soll sich das Gesamtunternehmen dann entwickeln – so der Plan.
Herden vor Wolfsrudel schützen
Eine große Herausforderung ist für den Nebenerwerbler auch die Nähe zum Truppenübungsplatz Ohrdruf, denn in der Region ist ein Wolfsrudel ansässig. 2018 gab es zwei Übergriffe. „Damals stand die Frage, ob ich aufhöre oder in den Herdenschutz investiere.“
Auch die zuständige Natura-2000-Station wollte, dass er weitermacht. Im Herbst des gleichen Jahres wurden zwei Herdenschutzhunde angeschafft. Inzwischen sind es sechs. „In jeder Herde mindestens zwei“, sagt Dübner, der die Weidetiere in drei Herden aufgeteilt hat.
Der Herdenschutzzaun ist 1,40 m hoch. „Mehr als vom Land gefordert wird, denn mit Hunden hätten 90 Zentimeter gereicht.“ Dabei entschied sich Dübner für ein Zaunsystem, bei dem fünf Litzen auf einmal gezogen werden können. 2022 fiel ihm zufolge eins seiner Schafe einer Wolfsattacke zum Opfer. „Es lag außerhalb des Zauns. Es ist wahrscheinlich durchgebrochen und wurde dann vom Wolf gerissen“, mutmaßt er. „Wären die beiden Hunde nicht in der Herde gewesen, wäre sicher mehr passiert.“ 2023 gab es noch keine Vorfälle.

Landschaftspflege und Artenvielfalt
Dübners Herden pflegen die Landschaft. Die Natura-2000-Station Gotha/Ilmkreis verweist darauf, dass um die Wachsenburg vor Jahren viele Trocken- und Halbtrockenrasen bereits stark verbuscht waren und wiederhergestellt wurden. Um die Artenvielfalt habe der Schafhalter große Verdienste, heißt es. Darüber hinaus legte er u. a. eine sogenannte Hirschkäferwiege an.
Er brachte dazu Totholz in die Erde ein, deckte dieses ab und lockte so Hirschkäfer-Weibchen an. Der Erfolg stellte sich ein, er griff so der bundesweit stark gefährdeten Art unter die Arme. Ebenso legte Dübner Schutzäcker für gefährdete Ackerwildkrautarten auf seinen Eigentumsflächen an. Dennoch läuft die Zusammenarbeit nicht immer reibungslos. „Der Biber macht uns Sorgen“, sagt Dübner. Er befürchtet, dass wertvolle Winterfutterflächen vernässen und nicht mehr nutzbar sein könnten.

Das hat er auch schon den Verantwortlichen der Station klar gesagt. „Es muss alles im Rahmen bleiben, das Bemühen um den Artenschutz darf man nicht nur mit der rosaroten Brille sehen.“ Dennoch soll es weiter eine gute Zusammenarbeit geben. So würden derzeit Lösungen für Flächen gesucht, die in der Luft hängen. „Das Kulap ist ausgelaufen und bei der Neubeantragung sind wir zu 50 Prozent leer ausgegangen, weil die Gelder alle sind“, so der Landwirt. „Das ist ein unmöglicher Zustand – zumal das nicht die einzigen Baustellen sind.“
Er verweist auf teilweise horrende Pachtforderungen. Auf einem Magerrasen in Steillage habe das Anfangsgebot z.B. 400 €/ha betragen. „Unter diesen Bedingungen kann man keine Schafhaltung mehr betreiben.“ Viel Geduld und Gespräche seien notwendig gewesen, um einen verträglichen Wert auszuhandeln.
Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!
Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:
- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden
- Zuverlässig donnerstags lesen
- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen
- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion
- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv
Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!