Weder Untergang noch Wende
Die jüngst veröffentlichte „Farm-to- Fork“-Strategie der EU-Kommission stößt in der Landwirtschaft vielfach auf Kritik. Doch was steckt wirklich dahinter? Ein Blick auf fünf der Kernziele.
Während die erste Aufregung über die „Farm-to-Fork“-Strategie der EU-Kommission etwas abklingt, verdient dieser neue europäische Plan einige genauere Blicke. Denn die einen sehen den Untergang der abendländischen Landwirtschaft am Horizont dräuen, andere die langersehnte Agrarwende zum rundum Besseren vor sich. Aus Erfahrung ist der EU-Kommission aber weder das eine noch das andere zuzutrauen.
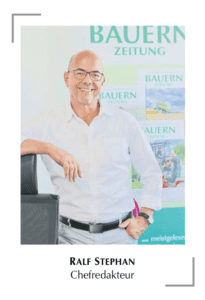
Wirklich enttäuscht vor allem eins: Eine Strategie mit dem großen Anspruch, von der „Farm“ bis zur „Fork“, der Gabel in der Hand des Verbrauchers, zu denken, hätte tatsächlich einen Ansatz für die gesamte Lebensmittelkette liefern müssen. Konkrete Ziele sind jedoch nur in Bezug auf die Landwirtschaft formuliert – obwohl die Strategie nicht vom Agrarkommissar, sondern von der Gesundheitskommissarin verantwortet wird. Hier ist agrarpolitisch in jedem Fall nachzubessern, soll „Farm-to-Fork“ am Ende tatsächlich, wie versprochen, auch die wirtschaftliche Lage der Landwirte verbessern.
Die Kernziele der „Farm-to- Fork“-Strategie
Besteht dazu überhaupt eine Chance mit einer Strategie, die die EU-Bauernverbände schon bei ihrem Erscheinen als „Generalangriff auf die europäische Landwirtschaft“ gebrandmarkt haben? Sehen wir uns die fünf Kernziele der Strategie bis 2030 dazu doch einmal an:
- 50 % weniger synthetische Pflanzenschutzmittel;
- 20 % weniger Düngemitteleinsatz;
- 25 % Ökolandbau im EU-Durchschnitt;
- 10 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche sollen vorrangig dem Schutz der Artenvielfalt dienen;
- 50 % weniger Antibiotika in der Tierhaltung.
Auf den ersten Blick könnte es einem echt die Sprache verschlagen. Selbst wenn zum Umstellen auf Öko ja niemand gezwungen wird. Aber Achtung: Es geht um den EU-Durchschnitt! Auch Brüssel weiß, dass sich in Regionen mit 30 kg Bilanzüberschuss weniger Stickstoff einsparen lässt als dort, wo die mehrfache Menge gedüngt wird. Auch Pflanzenschutz läuft in Mais und Roggen anders ab als in Paprika oder Wein. In den anstehenden politischen Gesprächen muss es aus ostdeutscher Sicht deshalb vor allem darum gehen, differenziert auf regionale Verhältnisse und Potenziale zu reagieren.
Weniger Pflanzenschutz und Antibiotika sind nichts neues
An weniger Pflanzenschutz auf dem Feld und weniger Antibiotika im Stall wird hierzulande schon seit Jahren gearbeitet. Zudem proklamiert Brüssel ebenso klar sein Ziel, die EU-Bürger auch in Krisenzeiten verlässlich mit gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen. Mit Verboten allein ist das nicht machbar. Gebraucht wird eine Strategie für diese Reduktion, begleitet zum Beispiel von der erleichterten Zulassung besserer Wirkstoffe, vom aufgeschlossenen Einsatz moderner Züchtungsmethoden, von der ausreichenden Finanzierung praxisnaher Agrarforschung und firmenneutraler Beratung und nicht zuletzt von Investitionshilfen für neue Technik und tiergerechtere Ställe.
Spitze Zungen behaupten, fünf bis zehn Prozent Biodiversitätsflächen waren in vielen östlichen Ackerbautrieben früher üblich – bis InVeKos kam und man alles plötzlich ganz genau nehmen musste. Wie dem auch sei: Wo heute noch geackert und gemäht wird, könnte unter veränderten Klima- und Marktbedingungen der Artenschutz schon bald das bessere Geschäftsmodell sein. Vorausgesetzt, es gibt tatsächlich einmal öffentliches Geld für solche öffentlichen Leistungen. Die jetzt bekannt gewordenen Ansätze im Finanzrahmen für die nächste GAP-Periode werden dafür bei Weitem nicht reichen. Bis aus der „Farm-to-Fork“-Strategie der Kommission ein echter Plan für eine umweltgerechtere und trotzdem leistungsfähige Landwirtschaft wird, bleibt also noch viel zu tun.

